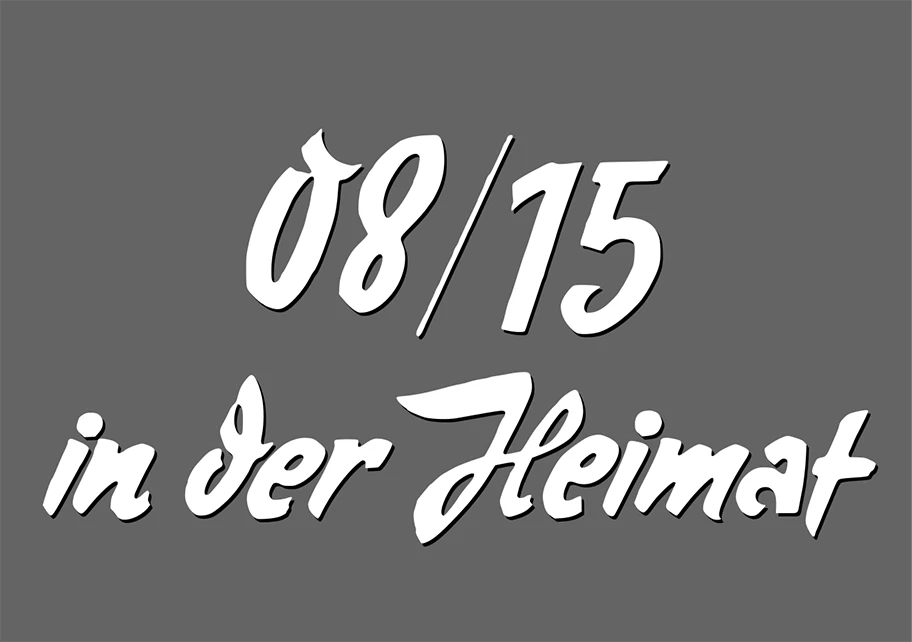Zur selben Zeit aber, als diese Debatte in meine Twitter-Timeline einbrach, war ich gezwungen, mich mit Gedanken zu beschäftigen, die das diabolische Thema irgendwie streiften. Zum einen nämlich bemerkte ich den Widerspruch, der sich zwischen den Sprachwelten entspann, in denen ich mich bewegte. Ich bin ja immer noch in Rojava und wenn ich kurdisch spreche, mich mit kurdischen Freunden austauschte, spreche ich selbstverständlich vom „Volk“ oder von „unserer Heimat“. Auf Deutsch hätte ich dasselbe wohl umschrieben, von „der Bevölkerung“ geredet oder von dem „Land, aus dem wir kommen“. Das machte aber übersetzt gar keinen Sinn, erst recht nicht in politischem Kontext.
Zum anderen aber betrifft mich Heimat nun auch noch auf andere Weise. Ich habe nämlich seit einigen Monaten wachsendes Heimweh. Ein sonderbares Gefühl. Versteht man sich als Revolutionär, sollte man es eigentlich nicht fühlen, oder doch? Was vermisse ich eigentlich? Was heisst eigentlich Heimat, für jemanden, der Nationalstaaten und ihren Patriotismus ablehnt? Die spontane Antwort war einfach: Ich vermisse meine Genoss*innen und meine Familie, mehr als alles andere. Ich vermisse bestimmte Orte, mit denen ich schöne Erfahrungen verband: Die Herbstwälder Brandenburgs, die Thekenstimmung in der Kreuzberger Meuterei, Klettern am RAW-Gelände. Ich vermisste auch die Kultur, die ich gewohnt war: Punkrock, Picknick am See, Milchkaffee am Heinrichplatz. Natürlich diskutiere ich dieses Gefühl mit Genoss*innen und mir selber, denn schliesslich ist ja auch eine unserer Aufgaben hier, bei allem, was sich so in uns abspielte, nachzufragen, ob es sich für eine militante Persönlichkeit eigne oder nicht. Die Meinungen gehen auseinander: Einige halten es für eine liberale Abirrung, denn schliesslich sind wir Revolutionär*innen und müssen dort zuhause sein, wo wir gerade kämpfen. Andere betonten, dass es dennoch eine gute Regung sei, denn schliesslich sei die Bindung an die eigenen Genoss*innen eine der wichtigsten Eigenschaften jedes und jeder Militanten.
Kampf um Bedeutung
Wie auch immer man es hin- und herschiebt: In jedem Fall ist diese Bindung an die Heimat nichts Schockierendes, sondern eine menschliche Regung, die man auf ihre Gründe hin befragen kann. Bemüht man eine der Umfragen, die zu dem Thema fabriziert wurden, findet man heraus: 91 Prozent der Deutschen empfinden Heimat als einen positiven Wert. So weit, so trivial. Interessanter ist, was die Umfrage zu den Inhalten dieses Begriffs sagt: 92 Prozent definieren Heimat über „Menschen, die ich liebe bzw. mag“. Andere populäre Bedeutungskomponenten: der Ort, an dem man wohnt, Gefühle wie „Sicherheit“ und „Geborgenheit“ und weniger, aber doch noch sehr wichtig: Traditionen, Mundarten, Gebräuche.Die Verwendung des Begriffs Heimat im Alltag hat viele Aspekte, die für politisches Handeln bedeutend sind: Der Begriff ist ziemlich diffus; er hat Bedeutungskomponenten, die offen sind für rechte wie linke Inhalte; er spiegelt Sehnsüchte wieder, von denen diejenigen, die sie in ihm sehen, oft selbst nicht klar und deutlich wissen; und er hat immer auch diesen Bezug auf das (Noch-)Nicht-Vorhande, das, was Bloch die „unfertige Heimat“ nennt.
Wie der Begriff jeweils bestimmt ist, ist auch Ergebnis und Ausdruck gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. In Rojava zum Beispiel ist der Begriff der Heimat, welat, allgegenwärtig. Familien, die der kurdischen Befreiungsbewegung nahestehen, heissen welatparêz, diejenigen, die die Heimat schützen. Die derzeit laufende Kampagne der Jugend Rojavas trägt den Namen welat welate me soz soza me: Die Heimat ist unsere Heimat, der Schwur ist unser Schwur. Linke Zeitungen heissen azadiya welat, Freiheit der Heimat, unter Guerillas ist welat ein gängiger Kampfname.
Gleichzeitig bedeutet dieses welat nicht eine Heimat etwa exklusiv für Kurd*innen. Oder exklusiv für Sunnit*innen. Oder für sonst irgendeine ethnische, religiöse Gruppe. Es ist das gemeinsame welat, das von allen mit allen für alle aufgebaut werden soll. Es ist die Heimat der gesamten Revolution. Und klar, auch welat hat seine Feinde, sein aussen: diejenigen, die die Revolution ersticken wollen.
Jetzt gibt es natürlich einen massiven Unterschied zwischen der Verwendung von Heimat bei antikolonialen Bewegungen und innerhalb imperialistischer Staaten mit lebendiger faschistischer Tradition wie Deutschland. Und dennoch zeigt das Beispiel: wie ein Begriff, der dermassen politisch ist, konnotiert ist, hängt davon ab, wer die Hegemonie über seine Deutung hat.
Anbiederung und Publikumsbeschimpfung
Wie man damit umgeht, ist damit allerdings noch nicht gesagt. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die deutsche Linke wählt zielstrebig die zwei muffigsten. Ein Gros der liberalen Linguistik-Linken tut, was es immer tut: Den Begriff und seine Verwender diabolisieren, zu Krypto-Nazis erklären und zu meinen, mit Verboten im „eignen“ Lager (auf irgendjemanden sonst hat man ja ohnehin keinen Einfluss) eine Diskursverschiebung nach rechts zu vermeiden. Man druckt dann poppige Sticker, auf denen „Heimat halt's Maul“ steht, klebt sie in irgendwelche Dörfer, in denen man politisch nicht arbeitet, und sieht sich bestätigt, wenn der Volksmob tobt: Sehet, wie verdorben der Pöbel ist, der die in drölfzig Soziologieseminaren ersonnene und von professionellen Layoutern in Form gegossene Aufklärung nicht versteht.Die Gegenbewegung kehrt die Publikumsbeschimpfung in Anbiederung um: Professionelle Politiker*innen wie Sahra Wagenknecht oder Bodo Ramelow nehmen den Heimat-Begriff in der Hoffnung auf, er möge ihnen einen noch besseren Platz an den Futtertrögen des Parlamentarismus bescheren. Sie nehmen ihn einfach so, wie die Faschisten ihn liegen lassen und schwächen seine Konnotationen einfach ab. Klar, Heimat ist dann nicht mehr ganz so viel Blut, Boden und reaktionäre Tradition. Aber Heimat ist immer noch irgendwas im Kontext von Flüchtlings- und Sicherheitsdebatte, irgendwas mit weniger Refugees und mehr Bullen.
Jenseits von Anbiederung und geradezu panischer Angst vor dem Heimat-Begriff gibt es eine andere Möglichkeit. Man könnte darüber nachdenken, was an diesem Begriff so identitätsstiftend wirkt und versuchen, ihn anders zu besetzen. Man könnte den utopischen Überschuss, der im Heimat-Begriff liegt, herausarbeiten. Die Heimat, die sich alle lower classes, vom Refugee bis zum ostdeutschen Bauarbeiter, noch erst schaffen müssen, weil sie im Kapitalismus überhaupt nirgendwo existiert. „Die vergesellschaftete Menschheit im Bund mit einer ihr vermittelten Natur ist der Umbau der Welt zur Heimat“, schreibt Ernst Bloch. Oder vielleicht massentauglischer wie bei Feine Sahne Fischfilet: „Mit Heimat meine ich keine Nation, mit Heimat mein' ich keinen Staat. Mit Heimat meine ich Familie, Freunde, wo man Zukunft sieht. Wo man sich wohlfühlt, wo man lenkt und wo man liebt.“ Das bedeutet noch nicht einmal, dass man Heimat in Slogans verwursten muss. Aber man sollte versuchen, ernst zu nehmen, welche Sehnsüchte sich in Begriffen wie Heimat ausdrücken und nicht immer a priori meinen, es sei nichts anderes als die Sehnsucht nach dem Pogrom.
Mehr Mut
Sicher, letzteres Konzept setzt voraus, die eigene Furcht davor zu überwinden, quasi automatisch selber zum Nazi zu werden, wenn man Begriffe verwendet (oder nur laut über sie nachdenkt), die sich die Rechte angeeignet hat. Diese Furcht sitzt tief in Teilen der „deutschen Niederlagenlinken“ (Abdullah Öcalan), die kaum noch Glauben an die eigenen Ideen hat.Wer unerschütterlich davon überzeugt ist, dass die eigene gesellschaftliche Utopie den mörderischen Versprechen der Faschisten genauso wie denen der verschiedenen Advokaten des mörderischen Bestehenden überlegen ist, muss sich nicht vor dem Kampf um Begriffe fürchten. Wer nicht schwankt in seinen Überzeugungen, muss auch nicht ständig davor zittern, von ihnen abzufallen. Wenn wir wissen, wofür wir kämpfen, können wir von Haus zu Haus, von Stammtisch zu Stammtisch, von Arbeitsplatz zu Jobcenter ziehen und dort, wo es nötig ist, auch mal sagen: Tamam, lasst uns drüber diskutieren, was ihr eigentlich unter dieser Heimat versteht, die euch so viel bedeutet. Die besseren Waffen hätten wir allemal: Denn eine noch zu schaffende Heimat als Ort des gelingenden Lebens ist allemal attraktiver als die stumpfe Landser-Verklärung der Höckes und Gaulands.