Sara Horowitz: Mutualism Erfahrungsbericht aus der mutualistischen Praxis
Sachliteratur
„Mutualismus“ ist eine Bezeichnung, die im deutschsprachigen Raum in der linken Szene weitgehend unbekannt ist. Im Englischen und Französischen ist das Wort geläufiger und bezeichnet nichts weiter als „Gegenseitigkeit“ oder „Reziprozität“.
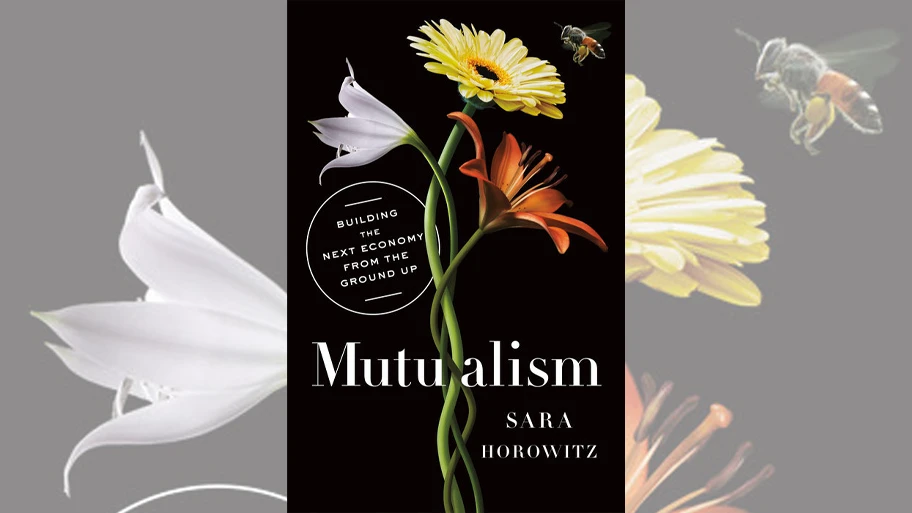
Mehr Artikel
Buchcover.
2
0
Einerseits geht diese Tradition auf die frühe Arbeiter*innenbewegung zurück und wurde ausgiebiger von Pierre-Joseph Proudhon thematisiert. Andererseits scheinen mir eine Vielzahl von Praktiken in linken Szenen ganz eindeutig von mutualistischen Prinzipien, Verständnissen und Erfahrungen geprägt zu sein.
Hauptsächlich wird hierbei auf die die Organisationsform der Genossenschaft gesetzt. Menschen schliessen sich anhand ihrer unmittelbaren Interessen, wie Wohnung, Konsum, Freizeit, Gesundheit oder in Kollektivbetrieben zusammen und profitieren individuell davon, Anteil an diesen selbstorganisierten Strukturen zu haben, über welche sie basisdemokratisch mitbestimmen können. Diese Praxis findet sich beispielsweise im Mietshäusersyndikat, in Solidarischen Landwirtschaften und kooperativen Betrieben, bei „Küchen für Alle“ und in Umsonstläden, Selbsthilfe-Reparaturwerkstätten, nicht-kommerziellen Fussballvereinen oder selbstorganisierter Sucht-Hilfe.
Als ich auf das Buch von Sara Horowitz stiess, hoffte ich mir einen Einblick in die Ideengeschichte und grundlegenden Prinzipien von mutualistischen Bewegungen zu erhalten. Stattdessen stiess ich eher auf eine Art Erfahrungsbericht einer langjährigen Gewerkschaftsaktivistin, jüdischer Herkunft aus New York, welche die „Freelancers Union“ gegründet hat. Damit leistete sie vermutlich einen wichtigen Beitrag, Menschen in neuen Arbeitsverhältnissen zu organisieren, welche deutlich vereinzelter, flexibler und undurchsichtiger sind, als die traditionellen Arbeitsverhältnisse. Um ehrlich zu sein, warf mich die Lektüre nicht besonders um. Zugleich muss ich zugeben, dass ich keine Ahnung von Alternativökonomie habe und dass die wesentlichen Dinge, die es anders zu strukturieren und zu gestalten gilt, ganz alltäglich und unspektakulär sind. In diesem Sinne kann mit dem mutualistischen Ansatz Tätigsein entgegen der Lohnarbeits-Form neu gedacht werden. Beispielsweise kann damit danach gefragt werden: Inwiefern ist die grundlegende Umgestaltung unserer Arbeit eine wesentliche Vorbedingung für die Transformation der Gesellschaft insgesamt? Welche Tätigkeiten fühlen sich sinnvoll an? Welche Arbeitsabläufe funktionieren für uns persönlich? Welche Gruppenstrukturen und -prozesse tun uns gut? Welchen Stellenwert nehmen unsere gesellschaftlichen Tätigkeiten für uns ein? Wie gestalten wir unsere frei verfügbare Zeit, wenn „Freizeit“ komplementär zur Lohnarbeit definiert wird? Wie wären wir tätig, wenn die Sicherheit unserer Lebensgrundlagen nicht von der Arbeit abhängig wäre?
Pseudo-kritische, marxistisch geprägte Sozialdemokrat*innen behaupten (in Kürze), die Wirtschaft umzubauen und andere ökonomische Beziehungen aufzubauen, würde überhaupt nichts bringen. Denn am Ende hätten wir es ja immer noch mit dem Kapitalismus als Gesamtsystem zu tun, in welchem es keinen Unterschied machen würde, Nischen aufzubauen oder dass diese sogar zur Erneuerung des Kapitalismus beitragen würden. Je älter ich werde, desto bescheuerter finde ich diese fatalistische Fundamentalkritik. Denn im Grunde genommen ist es genau anders herum:
Wenn Menschen keinen alternativen Wirtschaftsformen aufbauen, können sie nicht lernen und veranschaulichen, dass dezentrales sozialistisches Wirtschaften möglich ist.
Wenn wir keine Strukturen der gegenseitigen Hilfe aufbauen, die Menschen tatsächlich etwas bringen, werden wir nie über die Szene-Grenzen von ideologisch überzeugten Personen hinaus gelangen, weil wir nicht an den Interessen ansetzen.
Wenn es keinen mutualistischen Organisationen gibt, verfügen wir nicht über die notwendige Solidarität, auf die wir aber angewiesen sind, um anarchistische Haltungen zu entwickeln und emanzipatorische Kämpfe führen zu können.
Dass Ansätze zur Alternativ-Ökonomie auf einem verkürzten Kapitalismusverständnis beruhen können; dass Szene-Angehörige sich damit Nischen schaffen, in denen sie häufig versacken; dass man mit ein paar genossenschaftlichen Strukturen nicht die gesellschaftlich verbreitete Konkurrenz und das unsolidarische Verhalten von Menschen einfach aufheben kann; dass darin entwickelte alternative Arbeitsprozesse, hierarchiearme Organisationsstrukturen usw. in der neoliberalen Selbstunternehmer-Kultur aufgegriffen und verwertet wurden und werden – all das stimmt. Darüber muss kritisch gesprochen und reflektiert werden. Doch wenn der Kapitalismus tatsächlich zusammenbricht – wie überleben und wirtschaften wir, wenn wir nicht weiter auf Vater Staat und die grossen Unternehmen als Lösungen setzen können und wollen? – Das Nachdenken über dezentrale sozialistische Wirtschaftsformen sollte kein Hobby von Startup-Gründern sogenannter „Sozial-Unternehmen“ bleiben, sondern ein Thema, zu dem Anarchist*innen eine Ansicht haben und äussern können.
Wie erwähnt, berichtet Horowitz von ihren Erfahrungen in diesem Bereich und diese Herangehensweise finde ich wichtig, auch wenn ich davon kaum Ahnung habe. Es folgen noch drei von mir übersetzte Zitate: Mutualistische Organisationen haben ein soziales Ziel: die Lösung eines sozialen Problems für eine Gemeinschaft. Eine auf Gegenseitigkeit beruhende Organisation existiert, um ihren Mitgliedern zu dienen, nicht um Gewinn zu machen.
Mutualistische Organisationen müssen über einen unabhängigen, nachhaltigen Wirtschaftsmechanismus verfügen. Die Einnahmen müssen die Ausgaben übersteigen. Mit anderen Worten, eine Gegenseitigkeitsorganisation muss eine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen.
Mutualistische Organisationen sind langfristig ausgerichtet. Sie sind generationenübergreifende Institutionen mit Führungsinfrastrukturen und Kapitalstrategien, die sie in die Lage versetzen, auch künftigen Generationen zu dienen. Sie sind so aufgebaut, dass sie ihre Mitglieder überdauern. (S. 33)
Dieser wechselseitige Instinkt ist so alt wie die Menschheit und ebenso langlebig. Auf diese Weise haben die ersten Amerikaner ihre grundlegendsten Bedürfnisse befriedigt, die Arbeiterbewegung hat die amerikanische Wirtschaft verändert, indem sie in den 1910er und 20er Jahren das erste Sicherheitsnetz für die Arbeiter geschaffen hat, der New Deal hat dieses Sicherheitsnetz in der Mitte des amerikanischen Jahrhunderts verankert und erweitert, und eine bemerkenswerte Koalition von mutualistischen Organisationen hat die Bürgerrechtsbewegung in Schwung gebracht, indem sie über Jahrzehnte hinweg Macht aufgebaut hat. Im Laufe der Jahre haben mutualistische Institutionen viele Namen und Formen angenommen – religiöse Gruppen, Kommunen, Hilfsvereine auf Gegenseitigkeit, Genossenschaften, Gewerkschaften, Vereine zur gegenseitigen Hilfe, Kibbuzim, Rentengesellschaften, brüderliche Gesellschaften, Frauenorganisationen, Handelsverbände -, aber sie alle entspringen einem gemeinsamen Impuls: Wenn weder die Regierung noch die Marktkräfte ein Problem lösen, das Sie und die Menschen in Ihrer Gemeinschaft teilen, warum lösen Sie es nicht selbst?
Seit Jahrzehnten sammle ich Geschichten aus unserer mutualistischen Vergangenheit, und ich habe festgestellt, dass die tiefgreifendsten sozialen Veränderungen oft ganz einfach beginnen, wenn sich Gruppen von Menschen zusammenfinden, um ihre eigenen Probleme zu lösen, indem sie die Institutionen aufbauen, die sie brauchen, und zwar in der Regel aus rein praktischen Erwägungen heraus. Gegenseitigkeit ist eigentlich nur ein anderes Wort für eine einfache Wahrheit: Die Bürger können sich zusammentun, um ihre eigenen Probleme zu lösen, selbst die unlösbarsten. In einer Zeit, in der sich unsere Regierung völlig aus der Verantwortung gezogen hat, können wir es uns nicht mehr leisten zu warten. (S. 3)
In der Biologie gibt es überall voneinander abhängige Ökosysteme, die auf Gegenseitigkeit beruhen. Einige von ihnen sind unsichtbar: Die meisten Pflanzenarten auf der Erde tauschen Nährstoffe mit unterirdischen Netzwerken von Pilzen in einem Prozess namens Mykorrhiza aus. Einige sind jedoch direkt vor unseren Augen sichtbar: Jedes Mal, wenn Sie eine Biene beobachten, die eine Blume in Ihrem Garten bestäubt und dafür den Zucker in ihrem Nektar erhält, sind Sie Zeuge eines biologischen Gegenseitigkeitsverhältnisses. Man könnte sogar behaupten, dass das meiste Leben auf der Erde mit dem ersten Austausch auf Gegenseitigkeit begann. Vor mehr als einer Milliarde Jahren verschlang ein einzelliger Klecks, der Vorfahre jeder Zelle in Ihrem Körper, eine andere und begründete damit die für beide Seiten vorteilhafte Beziehung, die die Grundlage fast allen Lebens auf der Erde bildet: die Beziehung zwischen der Zelle und ihrem Energielieferanten, den Mitochondrien. Der Mutualismus gilt nicht nur für die Pilze unter uns. Wir selbst waren Mutualisten, bevor wir Kapitalisten oder Sozialisten waren. (S. 23)
Sara Horowitz: Mutualism. Random House 2021. 272 Seiten, ca. 33.00 SFr. ISBN: 978-0593133521.


