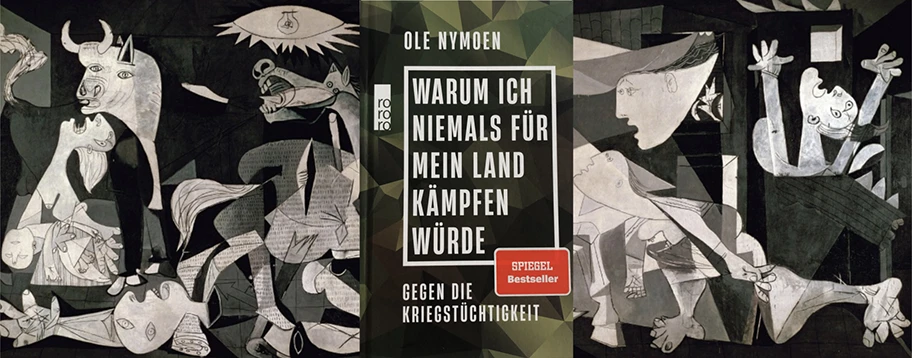Kriegslogik und Staatlichkeit
Nymoen arbeitet heraus, dass Krieg die logische Konsequenz staatlicher Souveränität im internationalen System ist: Staaten müssen ihre Handlungsfähigkeit in Konkurrenz zu anderen Staaten behaupten und greifen dabei immer wieder auf militärische Mittel zurück. Diese Bestimmung ist zutreffend, bleibt jedoch in einer problematischen Hinsicht unvollständig: Der Widerspruch zwischen Staat und Gesellschaft wird primär auf die Kriegssituation bezogen. Damit entsteht der Eindruck, als sei erst die extreme Eskalation des Krieges der Punkt, an dem der Staat seine Bürger zu Instrumenten degradiert.Kapitalistische Friedensordnung als Voraussetzung der Kriegslogik
Eine materialistische Staatskritik würde demgegenüber betonen, dass die instrumentelle Verfügung des Staates über „seine Bürger“ bereits in Friedenszeiten systematisch angelegt ist. Der Staat gründet die gesellschaftliche Reproduktion auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln und zwingt so die Mehrheit der Bevölkerung zur Lohnarbeit. Die staatliche Ordnung – Recht, Polizei, Gerichte – sichert diesen Zwang ab, indem sie die Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln aufrechterhält.In diesem Kontext ist auch der Sozialstaat nicht als fürsorgliche Einrichtung zu verstehen, sondern als Mechanismus zur Sicherung der Verwertungsfähigkeit der Arbeitskraft. Er stabilisiert die „Humanressourcen“ für die kapitalistische Produktion und reproduziert die Arbeitskraft als funktionale Variable des Akkumulationsprozesses. Die Logik der „Kriegstüchtigkeit“ setzt damit nicht qualitativ neu ein, sondern radikalisiert eine bereits bestehende Struktur: Bürgerinnen und Bürger werden im Frieden als Arbeitskräfte vernutzt, im Krieg als Soldaten.
Krieg, Kapitalismus und Weltordnung
Nymoen beschreibt Kriege als Ausdruck von Souveränitätskonflikten zwischen Staaten. Eine stärkere theoretische Zuspitzung wäre möglich gewesen, wenn diese Konflikte explizit in den Rahmen der kapitalistischen Weltökonomie gestellt worden wären. Die globale Ordnung ist nicht nur eine politische, sondern vor allem eine ökonomische Konkurrenzordnung, die durch hegemoniale Mächte (nach 1945 insbesondere die USA) durchgesetzt wird.Staaten handeln nicht lediglich aus subjektiven Machtinteressen „weniger Herrschender“, sondern aus der Notwendigkeit, ihre Position in der weltweiten kapitalistischen Konkurrenz zu behaupten. Diese Dimension deutet Nymoen zwar an – etwa wenn er auf die Ambitionen Deutschlands in der EU und die „Zeitenwende“ verweist –, eine konsequente Einbettung seiner Argumentation in eine Analyse imperialistischer Konkurrenzordnungen bleibt jedoch aus. Damit bleibt seine Kritik eher normativ (Absage an Kriegsteilnahme) als analytisch-strukturell fundiert.