Lyndal Roper: Für die Freiheit 500 Jahre für die Freiheit
Sachliteratur
"Für die Freiheit" von Lyndal Roper ist mit ca. 480 Textseiten nicht nur umfangreich, sondern ermöglicht auch den Einstiegs in die historiografische Denkweise.
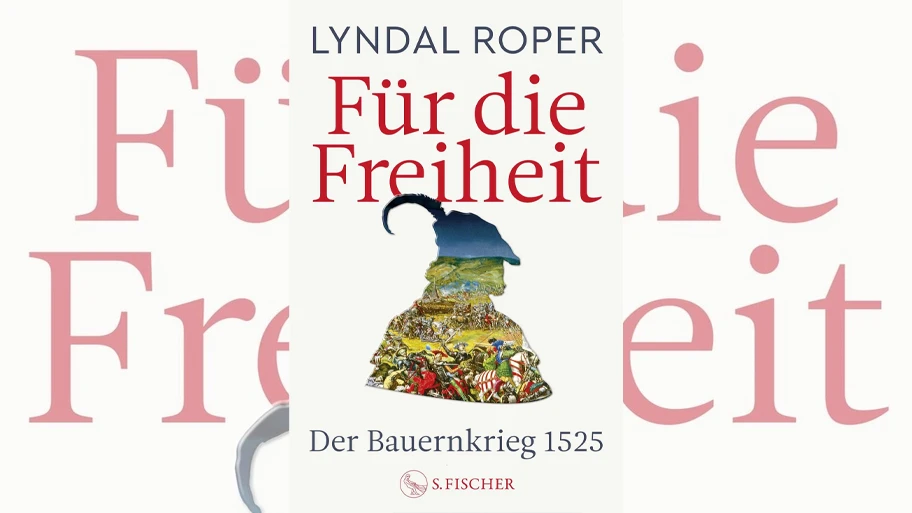
Mehr Artikel
Buchcover.
3
0
Die Autorin ist Geschichtsprofessorin und gibt an, bereits 1975 den Anstoss zur Beschäftigung mit dieser Phase der deutschen Geschichte erhalten zu haben, da in der DDR das 450jährige Jubiläum zur Nationbildung des realsozialistischen Staates diente. In diesem Zusammenhang wurde der radikale Geistliche Thomas Müntzer als Gegenpol zum die Obrigkeit stützenden Martin Luther, als Anführer der Bauern-Revolution inszeniert. Mit dieser staatstragend-marxistischen Geschichtsschreibung (Max Steinmetz, Günter Vogler, Siegfried Bräuer), mit der sich bereits Marx und Engels beschäftigt hatten, wird jedoch verkannt, dass die Bauern nicht nur Beiwerk oder gar konservativer Hemmschuh der neuzeitlich-bürgerlichen Gesellschaftstransformation waren, sondern selbst Subjekt sind, mit ihren eigenen Lebensweise, Vorstellungen und eigenen Interessen.
Ferner wird auch mit dieser linkspolitischen Sicht, die Darstellung revolutionärer Ereignissen als heroische Auseinandersetzung zwischen herausragenden Männern übernommen, die nicht allein verkürzt ist, wenn es z.B. um die Veränderung von Bedingungen zur Kapitalakkumulation oder Klassenstrukturen geht, sondern eine dezidiert männliche Sichtweise auf Geschichte verfestigt. Dies geschah auch mit der Vereinnahmung des Bauernkriegs durch den Nationalsozialismus, prominent durch Günther Franz. Dieser konstruierte mit ihm die Volksgemeinschaft und konnte leicht an die antisemitischen und organizistischen Konzepte anknüpfen, die im Bauernkrieg eine Rolle spielten. Da sich Franz' Arbeiten auf eine historisch fundierte Quellenarbeit stützten, gelang es ihm auch nach 1945 die faschistische Perspektive auf den deutschen Bauernkrieg weiter zu verbreiten. Dies ist bis heute der Fall: Die Wehrmachts-Version des Liedes „Wir sind des Geyers schwarzer Haufen“ ist millionenfach geklickt.
Dagegen stellt Peter Blickle mit seinem klassischen Werk zum Bauernkrieg von 1977 die „Empörung des gemeinen Mannes“ und damit popular-demokratische Verständnisse und Entscheidungsfindungen in den Vordergrund, mit denen auch der klassenübergreifende Bündnischarakter des „Aufwachens“ deutlich wird. Wie auch Roper betont, waren an der Revolution ebenso die Bergarbeiter, viele Bürger*innen, vor allem aus mittleren Städten, sowie einige Vertreter des niederen Adels vertreten. Blickle legt er den Fokus auf Südwestdeutschland und betrachtet jenseits von Luther, Müntzer (oder Andreas Karlstadt, den Roper ebenfalls behandelt), den Einfluss von Zwingli und anderen Schweizer Reformationstheologen.
Schliesslich kritisiert Roper auch, dass Fernands Braudels Klassiker Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts zwar „Mentalitäten“ und „Landschaften“ in den Blick nimmt, dabei jedoch die Bäuer*innen als eigene Subjekte aus den Augen verliert. In diesem Zusammenhang bezieht sich Roper auf den Ansatz neomarxistischer Kulturgeschichte, wie ihn Edward P. Thompson hervorgebracht hat. Ein grundlegendes Problem ist dahingehend allerdings, dass die wenigstens zeithistorischen Dokumente von den Aufständischen selbst stammten: Entweder handelt es sich um Berichte aus Perspektive der herrschenden Klasse, Protokolle von Verhören oder kulturelle Verarbeitungen, die erst einer Interpretation verlangen, um ihren Bezug und Gehalt zu den tatsächlichen Ereignissen herauszuarbeiten.
Die Autorin betont, dass es zum Verständnis der „Revolution des gemeinen Mannes“ am Beginn der Neuzeit nicht ausreichend ist, Zeitdokumente zu studieren – obwohl der aufkommende Buchdruck seinerseits eine wichtige Rolle zur Entstehung, Charakter und dem Verlauf des Bauernkrieges spielte. Die „Zwölf Artikel von Memmingen“, welche vermutlich Sebastian Lotzer aus den hunderten zirkulierenden lokalen Forderungskatalogen der Bäuer*innen zusammenfasste, stellen dahingehend tatsächlich eine eindrucksvolle intellektuelle Waffe dar, die mit den Abhandlungen und theologischen Disputationen der Reformatoren standhalten konnte.
In Bezugnahme und Abgrenzung zu den genannten Ansätzen entwickelt Lyndal Roper ihre komplexe Perspektive auf den Bauernkrieg. Zurecht wird sie nicht müde zu betonen, dass die Bauern mit ihrer zunächst klassenübergreifenden Betonung von „Brüderlichkeit“ zwar einen populär-demokratischen Anspruch vertreten und lebten, darin aber Frauen vergassen oder gezielt ausschlossen. Dies ist nicht lediglich im Kontext der Zeit selbstverständlich, sondern deutet auf eine Neuformierung des Patriarchats in der Neuzeit hin, die ebenfalls eine Voraussetzung für die Durchsetzung von Kapitalismus und Kolonialismus war. Weiterhin versetzt sich die Autorin erzählerisch in die Lebensumgebung und Vorstellungswelt der Bäuer*innen hinein, indem sie einer Vielzahl von Stimmen Gehör schenkt, Schriften und Bilder interpretiert, Sozial- und Klassenstrukturen mitbedenkt, widersprüchliches Verhalten aufzeigt und die offene und unklare Dynamik des Revolutionsverlaufs aufzeigt.
Der Bauernkrieg ist eine wichtige historische Phase, zum Einen, weil in ihm die Forderungen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, auf Gemeineigentum und Menschenrechte auf eine sehr wörtliche Weise vorweggenommen und eingefordert wurden. Zum anderen muss man um ihn wissen, um die kollektive Traumatisierung im Gedächtnis zu behalten, die durch die herrschenden Klassen ausgeübt wurde, als mindestens 75000 Menschen abgeschlachtet und viele weitere bestraft wurden, um die Herrschaftsordnung wiederherzustellen. Hierbei muss noch mal die Rolle der lutherischen Protestanten unterstrichen werden, die gerade aufgrund ihres reformatorischen Ansatzes, sich umso mehr den weltlichen Obrigkeiten anbiederten und zur Niederschlagung der Erhebungen drängten. Möglicherweise trug erst dies zur Konsolidierung der Reformation bei, die vom katholischen Gegenschlag bedroht war.
Neben der praktischen Säkularisierung zahlreicher Klöster, der Verbannung des übermässigen Prunks des höheren Klerus und der Zerstörung von Burgen des niederen Adels, der sich ohnehin auf dem absteigenden Ast befand, blieb vermutlich mehr übrig, als das kollektive Trauma der niedergeschlagenen Revolution. Nach Ropers Darstellung wird deutlich, das Geschichte durchaus offen und unklar ist, das Dinge passieren können und das Umbrüche zwar ihre Ursache im verbreiteten Elend haben, zugleich aber auch von Glauben und Hoffnung gespeist sind. Nur aufgrund materiellen Mangels (vielfacher Besteuerung, Abgaben, Privatisierung von Gemeingütern) und politischer Demütigung (Zwang zur Ortsgebundenheit, Vorgaben für Heiraten, willkürliche Rechtsprechung etc.), stehen Menschen nicht auf, gerade weil diese erdrückend sind. Sie erheben sich, weil sie eine Vision von einer besseren Welt haben, sie in ihrer Lebenssituation von Agitatoren angesprochen werden, welche ihre Sehnsüchte in Worte kleiden und einen gangbaren Weg aufzeigen, wie diese sich erfüllen lassen.
Lyndal Roper: Für die Freiheit. S. Fischer Verlag 2024. 676 Seiten. ca. 49.00 SFr. ISBN: 978-3-10-397475-1.


