Jodie Hare: Autismus ist keine Krankheit Neurodivergenz ernst nehmen
Sachliteratur
Seit einigen Jahren trendet das Thema Neurodivergenz in den sozialen Medien, vergleichbar mit queeren und trans Identitäten.
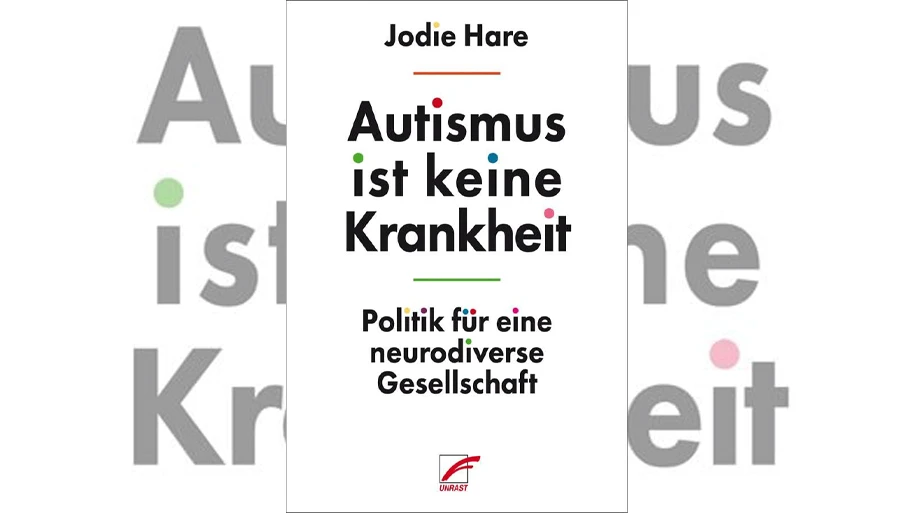
Mehr Artikel
Buchcover.
1
0
Bekannterweise schmücken sich Unternehmen, die als „progressiv“ gelten wollen, damit, z.B. „pink“ oder „inklusiv“ zu sein – und verschleiern damit, die strukturelle Ausgrenzung, die neurodivergente und/oder behinderte Menschen, analog zu queeren Personen im staatlichen Kapitalismus erfahren.
Darüber hinaus besteht ein „Trend“ darin, vermutete „Spezialfähigkeiten“ neurodivergenter Menschen gezielt auszubeuten oder sie überhaupt als produktiv in den Arbeitsmarkt zu integieren. Sicherlich besteht im Zeitalter von ausgeprägtem Individualismus und Identitäts-Zuschreibungen auch ein verbreiteter Hang zur Selbstdiagnostizierung – sei es, um in Gesprächen als interessant zu erscheinen, eigene Schwierigkeiten zu erklären oder sich der Selbstverantwortung zu entziehen. All diese gegenwärtigen Erscheinungen helfen leider jenen wenig, die tatsächlich als neurodivergent gelten. Darunter sind insbesondere autistische, ADHS, schizophrene, lernbehinderte und Menschen mit Down-Syndrom und Demenz zu fassen. Wenn diese Personen an den Standards und in den Kategorien neurotypischer Menschen gemessen werden, können sie im Grunde genommen nur als defizitär, „krank“ oder zugeschrieben-behindert angesehen werden.
Die Neurodivergenz-Bewegung geht von einem Verständnis aus, dass neurodivergenten Personen eigene Sichtweisen, Erfahrungswelten und Persönlichkeitsstrukturen zugesteht. Mit ihr wird auf den grundlegenden Respekt vor verschiedenen Existenzformen und Lebensweisen bestanden, während die Gesellschaft zugleich auf notwendige Unterstützungsleistungen verpflichtet wird.
In ihrem Buch gibt Jodie Hare einen aktuellen, umfassenden und gleichzeitig gut lesbaren und kurzweiligen Überblick, über Grundlagen, Perspektiven, Erfahrungen, Forderungen und Themen der Neurodivergenz-Bewegung. Dabei geht sie als autistische Person selbst von ihrer Sichtweise und Erfahrungswelt aus, ohne Allgemeingültigkeit zu beanspruchen. Erschreckend ist, dass ableistische Diskriminierung anhält und eugenische Bestrebungen fortleben, während zugleich immer deutlicher wird, dass Neurodiversität eine biologische und soziale Tatsache ist.
Mit grosser Sensibilität und dem Respekt, für welchen sie selbst eintritt, bezieht sich die Autorin auf Autismusforscher*innen, andere Fürsprecher*innen der Neurodivergenz-Bewegung (etwa Nick Walker, Robert Chapman, Judy Singer etc.) und soziologische Statistiken. Letztere belegen etwa, dass während der Covid-19-Pandemie autistische Personen systematisch als weniger lebenswert eingestuft werden; dass Arbeitslosigkeit unter autistischen Menschen häufig auf Diskriminierung und Ignoranz gegründet ist; dass autistische Menschen im Durchschnitt höher von Selbstmord, sexuellem Missbrauch, Wohnungslosigkeit, Drogenabhängigkeit und Polizeigewalt betroffen sind, als neurotypische Personen. Ähnlich wie Chapman geht Jodie Hare von einer fundierten intersektionalen Perspektive aus. Das heisst, sie betrachtet und bedenkt, wie etwa einerseits Neurodivergenz, Gender und ethnische Zuschreibung als Positionierungen, andererseits Neuronormativität, Patriarchat und Rassismus als Herrschaftsverhältnisse ineinandergreifen.
Die Autorin schreibt aus einer klar antikapitalistischen und emanzipatorischen Haltung heraus. Mit jener lehnt sie kapitalistische Verwertungslogik und staatliche Entmündigung grundlegend ab und kritisiert sie. Angesichts von Sparpolitiken im Gesundheits- und Pflegebereich ist es nachvollziehbar und notwendig, dass sie eine deutlich bessere Finanzierung dieser Sektoren jenseits ihrer Profitabilität fordert. Zugleich wird deutlich, dass der Staat selbst grundlegend ableistisch auftritt, wenn er Normalbürger*innen konstruiert, denen diese und jene Rechte und Freiheit gestanden oder abgesprochen werden.
Seine Legitimierung als Beschützer und Versorger von schwachen und verletzlichen Bevölkerungsgruppen widerspricht – trotz Inklusionsmassnahmen – der Realität seiner bürokratischen Hürden, knauserigen Sozialleistungen und der strukturellen Diskriminierung. Menschen werden auf verschiedene Weisen von Kapitalismus und Staat behindert und als „gestört“ erklärt. Auch die Verknüpfung von Ableismus mit Patriarchat und Rassismus ist offensichtlich.
Im Unterschied dazu werden neurodivergente Personen zwar häufig ebenfalls behindert, stellen sie aber eine Ausprägung von menschlichen Existenzweisen dar, welche endlich als Bereicherung statt als problematische Abweichung von der Norm angesehen werden sollte. Der Kampf für neurodivergente Befreiung hat gerade erst begonnen.
Jodie Hare: Autismus ist keine Krankheit. Politik für eine neurodiverse Gesellschaft. Unrast Verlag 2025. 200 Seiten, ca. 22.00 SFr. ISBN: 978-3897716315.


