Hendrik Wallat: Maximalismus. Studien zum politischen Denken von Issak Steinberg. Issak Steinberg – Theoretiker der Sozialrevolutionäre
Sachliteratur
Seit bereits einigen Jahren beschäftigte sich Hendrik Wallat mit dem wenig bekannten Theoretiker der Sozialrevolutionären Partei im Russland Anfang des 20. Jahrhunderts, Issak Steinberg.
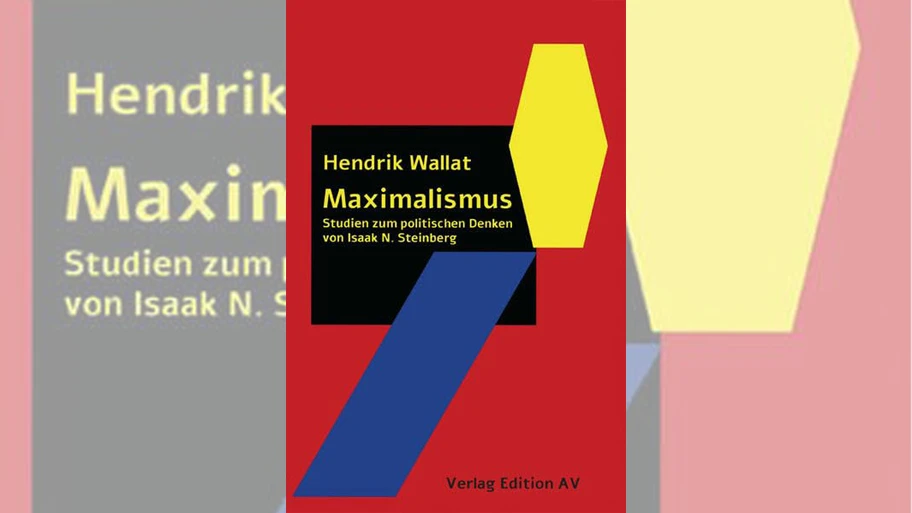
Mehr Artikel
Buchcover.
2
0
Wenig bekannt ist, dass es neben sozialdemokratischen Menschewiki, den leninistischen Bolschewiki, Trotzkist*innen und Anarchist*innen vor und während der Russischen Revolution um 1917 noch die Partei der Sozialrevolutionäre gab. In ihren Positionen war diese radikaler als die sozialdemokratische Strömung, weniger marxistisch und auf die Übernahme der Staatsmacht fixiert wie die bolschewistische Richtung, aber pragmatischer orientiert, als die anarchistische Bewegung.
Abgesehen davon, dass die Sozialrevolutionäre sich explizit auf die Bauernschaft beriefen und in dieser verankert waren, bezeichnete Steinberg mit „Maximalismus“ ebenfalls eine tendenziell anarchistische Herangehensweise: Es ging ihm darum, die Trennung von Zielen und Mitteln aufzuheben. Diese wurde einerseits ultra-politisch durch die Bolschewiki vollzogen, welche die Mittel ihren Zielen entsprechend rechtfertigten. Andererseits trennten die Sozialdemokrat*innen ebenfalls Ziele und Mittel und verschoben die Revolution zugunsten der Realpolitik auf den Sankt Nimmerleinstag. Anstatt sich heute mit dem Minimalen zu vertrösten, um in einer fiktiven Zukunft, sich dem maximal Erreichbaren anzunähern, gilt es, das Maximale aus den gegebenen Bedingungen herauszuholen. An den Ansatz einer adäquaten Vermittlung von Zielen und Mitteln, dockt ein Geschichtsverständnis an, welches ebenfalls wie bei den Anarchist*innen vom Hier&Jetzt ausgeht. Anders als jenen ging es den Sozialrevolutionär*innen aber um einen pragmatischeren Umgang mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Daher entwickelte der Jurist Steinberg eine differenzierte Staatstheorie, die auf dessen perspektivischer Überwindung abzielt, sich jedoch zugleich an der Realität seiner (veränderbaren) Funktionsweise in der Gesellschaft orientiert. In diesem Sinne wurde Steinbergs Position auch beim Kantine-Festival 2023 angeführt. Weiterhin interessant ist Steinbergs Insistieren auf die Bedeutung der Ethik während revolutionärer Prozesse, innerhalb von Organisationen und deren Programmatik.
Aus dem neuen Band habe ich den dritten Aufsatz Wallats gelesen: Die Anarchisierung der Macht. Issak Steinbergs politisches Programm eines libertären Sozialismus (S. 66-95). Dazu möchte ich einige Schwerpunkte herausstellen: Bereits im Titel werden die Schnittpunkte zum Anarchismus deutlich, ebenso jedoch, dass Steinberg die Realisierung einer bestimmten Gesellschaftsform ins Auge zu fassen. Ähnlich wie beim Rätekommunismus wird damit gewissermassen die politische Leerstelle des Anarchismus [Verweis] umkreist und zu füllen gesucht. Als Leitfaden dient Wallat dabei der programmatische Aufsatz Steinbergs Die Partei der linken Sozialrevolutionäre von 1921.
Was die „Anarchisierung“ der Staatsmacht betrifft, verweist Wallat auf fünf Kernpunkte, welche Steinberg für die Weiterentwicklung der Räte anstrebt. Etwas heruntergebrochen verstehe ich diese als: 1. Gewaltenteilung, 2. Dezentralisierung, 3. Demokratisierung, 4. Humanisierung / Abbau der Repression, 5. Die Entwicklung einer Zivilgesellschaft (S. 83-86). Interessanterweise ist Steinberg bewusst, dass auch bei der Umsetzung dieser Bestrebungen der Staat intakt und erhalten bleiben würde.
Gleichwohl kann vor dem Hintergrund damaliger und heutiger kapitalistischer Nationalstaaten davon gesprochen werden, dass die Staatsmacht damit bereits wesentlich reduziert wäre. Damit sich eine solche, libertär-sozialistische, Gesellschaftsform weiter anarchistischen Zielvorstellungen annähern könne, bräuchte es ferner eine Reduzierung von Fabriken, Technik und Maschineneinsatz (welche bspw. auch im Anarchosyndikalismus fetischisiert und gefeiert wurden).
Zugleich müsse ein funktionierendes „Leistungssystem“ für wirtschaftliche und politische Prozesse entwickelt werden – welches eine radikal dezentralisierte Wirtschaftsform weitgehend autonomer Kollektivbetriebe effektiv koordinieren kann (S. 87ff.). Ohne die Entwicklung „qualitativ neuer Formen der materiellen Reproduktion“, liesse sich keine andere Gesellschaftsform aufbauen. Darüber müsse man sich jedoch – anders als viele Anarchist*innen es wahrhaben wollten – durchaus Gedanken machen. Daraus ergibt sich:
„Wenn Steinberg auch eine ideologische Stellvertreterpolitik ablehnt, so vertritt er dennoch keinen illusorischen Spontaneismus, der die Problematik des revolutionären Massenbewusstseins leugnet. An die Stelle der leninistischen Kaderpartei setzt er die Idee der ‚initativen Minderheit', die vor und in der Revolution an vorderster Front agiert, niemals aber die ‚Kreativität der Mehrheit durch das Handeln der Minderheit' substituiert. Ohne eine revolutionäre Avantgarde kann sich auch Steinberg keine Befreiung denken. Glücken kann diese jedoch nur, wenn sie die ‚Energie' der Massen nicht enteignet, sondern freisetzt“ (S. 93).
In meinen Worten könnte dahingehend von einem Modus der begleitenden ‚convoyer-garde' der Sozialrevolutionär*innen gesprochen werden. Demnach lehnt Steinberg auch das zentrale Dogma des Leninismus ab: Die Diktatur des Proletariats. Statt einer Umerziehung der Menschen, die ihr eigenes Anliegen untergraben muss, geht es um die freiwillige Weiterentwicklung von Menschen, die aktiv am Aufbau einer libertär-sozialistischen Gesellschaftsform mitarbeiten wollen, weil sie in der allgemeinmenschlichen auch ihre eigene Emanzipation erkennen.
Hendrik Wallat: Maximalismus. Studien zum politischen Denken von Issak Steinberg. Edition AV, Verlag 2025. 289 Seiten, ca. 32.00 SFr. ISBN: 978-3868413267.


