Helge Döhring: 500 Jahre 1525. Thomas Müntzer und die Bauernkriege im Blick des Anarcho-Syndikalismus Noch 500 Cents zum Bauernkrieg
Sachliteratur
Aufgrund der jüngsten Proteste in Indonesien gegen schlechte Lebensbedingungen und Korruption verschaffte ich mir im Internet eine Einschätzung über die Vorgänge.
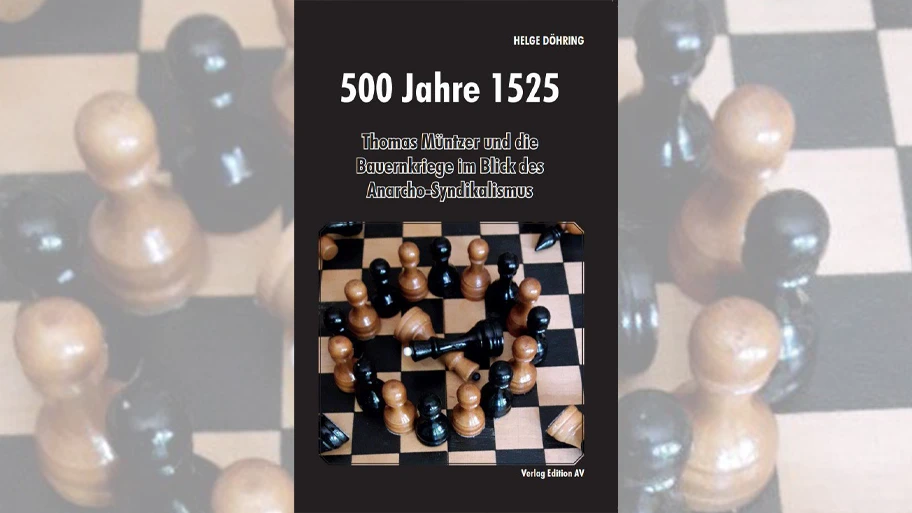
Mehr Artikel
Buchcover.
0
0
Die Beschäftigung des Autoren stellt sich als Vorläufer zu seinem Beitrag auf einem Podium des Kirchentages in Magdeburg 2017 heraus, dessen Verlauf Döhring schildert. Während im kulturprotestantischen Stil Martin Luther erinnerungspolitisch im gemeinsamen Interesse von Kirchen und konservativen Staatsteilen vermarktet und gehypt wurde, wird Müntzer eher darin maximal die Rolle eines gescheiterten Sidekicks zugewiesen.
Und es stimmt ja auch: Nach der destaströsen Schlacht von Frankenhausen am 15.05.1525 wird der „Regenbogen-Apokalyptiker“ umgebracht. Offenbar kann er als organischer Intellektueller der Bäuer*innen angesehen werden, zu denen er predigte und die er in die Schlacht gegen die Obrigkeit führte. Doch Müntzer hin, Müntzer her, ist dies nur ein Teil der Geschichte des Bauernkrieges. Döhring thematisiert, dass es mit den norddeutschen Stedingern eine interessante Vorgeschichte dazu gab: Ein Bund selbstorganisierter Bauern, die sich lange gegen fürstliche Zugriffe behaupten konnten und im Jahre 1234 brutal unterworfen wurden. Auch in England und Frankreich gab es schon im 13. und 14. Jahrhundert Aufstände der unteren Klassen. Die sogenannten Bauernkriege müssen als Revolution verstanden werden. Allerdings ist es hierbei wichtig, nicht moderne Kategorien auf Geschehnisse vor einem halben Jahrtausend zurückzuprojizieren. Der Autor verweist im Band auf die Dimensionen, welche in den gewaltsamen Auseinandersetzungen kulminierten: So kam es zur Veränderung der Bevölkerungsstruktur (Bevölkerungswachstum und Verarmung), wirtschafts- und finanzpolitischen Veränderungen (u.a. zunehmende Besteuerung), kulturell-politischen Umbrüchen (Aufkommen des Protestantismus in Konfrontation mit der Katholischen Kirche) und technischen Entwicklungen (hierbei insbesondere die Verbreitung des Buchdrucks).
Diese werden schliesslich von verschiedenen und widerstreitenden Intellektuellen interpretiert und Menschen für die jeweiligen Anliegen agitiert. In der Regel kam dies Predigern zu, von denen offenbar eine grössere Anzahl sozialrevolutionäre Gesinnungen entwickelte. Dahingehend erscheint Döhrings Hinweis darauf, dass religiöse und sozialrevolutionäre Denkweisen ineinander übergehen, als Scheinwiderspruch, der sich nicht stellt, wenn man sich in die gesellschaftlichen Verhältnisse Anfang des 16. Jahrhunderts hineinversetzt.
Das Eigenständige im Büchlein ist vor allem der Verweis auf die Anarcho-Syndikalisten Rudolf Rocker und Fritz Oerter, die die Bauernkriege zu ihrem 400 Jährigen Jubliäum würdigten. Damit arbeiteten sie an einer dezidiert anarchistischen Geschichtsschreibung und betteten die Aktivitäten des Anarcho-Syndikalismus in einen langanhaltenden Kampf um Emanzipation ein. Döhring versammelt dazu Dokumente und interpretiert diese. Ausserdem verweist er auf die Schauspielerin Vicki Spindler, welche sich aus der Perspektive von Ottilie Müntzer mit den Geschehnissen künstlerisch beschäftigt und diese aktuell thematisierte.
Bima Satria Putra: Anarchy in Alifuru. Autonomedia 2025. 136 Seiten, ca. 22.00 SFr. ISBN: 978-1-57027-395-7.


