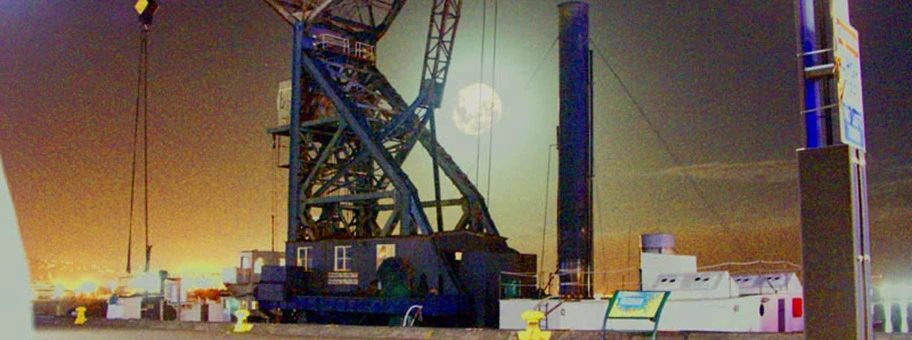Die Gruppen um die Zeitschrift „Gegenstandpunkt“ (GSP) sowie ihre Vorgängerorganisation (Marxistische Gruppe – MG) empfehlen sich als zuverlässige Instanz für gründliche Kritik und grundlegendes Wissen. MG und GSP zeigen sich seit 45 Jahren darin geschäftig, flächendeckend anderen nachzuweisen, letztere würden ebenso falsche wie letztlich affirmative Auffassungen über Kapitalismus, Staat und Ideologien verbreiten. Viele Sympathisanten von MG/GSP nehmen diesen Anspruch für die Tat. An einigen Beispielen wird in diesem Artikel geprüft, ob die „Kritik“, die MG/GSP vorbringen, ihren jeweiligen Gegenstand trifft.
Bei diesen Beispielen handelt es sich um die Auseinandersetzungen, die das Stahlwerk in Rheinhausen, die Kernkraftwerke und die „Nachrüstung“ betrafen. Ein weiteres Beispiel ist das israelische Kibbuz. Zum Thema werden auch Ausführungen des GSP zum kategorischen Imperativ, zum soziologischen Systembegriff und zum Verständnis des modernen bürgerlichen Rechtsstaats. Begründet wird jeweils, warum die dargestellten Fehler in den Stellungnahmen von MG/GSP relevante Streitfragen betreffen.
Fehleinschätzungen
Eine in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland markante Auseinandersetzung betraf den Erhalt des Stahlwerks in Rheinhausen 1987. MG/GSP stellen gern Kämpfe als erfolglos dar. Bspw. heisst es im Gegenstandpunkt 2/1993: „Die Gewerkschaft hat den radikalen Abbau von tausenden Arbeitsplätzen mitgetragen und dafür das vage Versprechen erhalten, über die endgültige Schliessung würde später entschieden und Unternehmer und Politik würden für neue Arbeitsplätze sorgen, soweit es geht. Das war in ihren Augen ein grossartiger Erfolg.“ Im Bestreben, die Arbeitenden zu mächtigeren und entschiedeneren Kämpfen zu agitieren, legt sich diese Sorte von Kritikern ausgerechnet darauf fest, den Kampf um Rheinhausen nicht als Beispiel dafür zu würdigen, was Arbeitende mit Kämpfen erreichen können. „Am Ende erreichten die Kollegen einen Sozialplan, den Laakman als den ‚besten Sozialplan aller Zeiten' bezeichnete: Den über 52-Jährigen wurden bis zur Rente 80% des Einkommens gezahlt. Die Jüngeren kamen in anderen Werken unter. ‚Wir haben keinen zurückgelassen', betont Laakman“ (Tügel 2017, S. 18). (Helmut Laakman hatte auf der Belegschaftsversammlung am 30.11.1987 „in Stahlarbeiterkluft eine Brandrede“ gehalten, die „abends über die ‚Tagesschau' in die Wohnzimmer der Bundesbürger flimmerte und die in Duisburg heute noch bekannt ist als ‚Auge um Auge, Zahn um Zahn-Rede'“ (Ebd.)„Stefan Willeke, der als Journalist damals dabei war, schrieb im Februar 2017 in der ‚Zeit': ‚Ich erlebte Arbeiter, die fähig waren zum Widerstand. Sie … erneuerten eine verheissungsvolle Botschaft: Ein Arbeiter muss kein armseliges Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse sein, er kann sich vom Objekt zum Subjekt erheben. Zumindest kann er es versuchen.'“ (Tügel 2017, S. 19) „Die Menschen in Rheinhausen haben deutlich gemacht, dass Politik und Unternehmen mehr anbieten müssen und nicht einfach so weggehen können. Das (Ergebnis – Verf.) ist kein Sieg. Aber es ist mehr als eine Niederlage“ (Hordt 2017). Für MG/GSP „existiert ein Ding entweder, oder es existiert nicht: Ein Ding kann ebensowenig zugleich es selbst und ein anderes sein“ (MEW 20, 21).
Bei einer anderen, nicht unerfolgreichen[2] sozialen Bewegung – gegen die Kernkraftwerke – beschränkte sich die MG nicht darauf, sie als nicht zielführend zu kritisieren, sondern agitierte frontal gegen sie. Zur gesamten (!) Anti-KKW-Bewegung fällt dem MSZ[3]-Leitartikel (Nr. 16/1977) gleich zu Beginn pauschal „die Angst vor dem Atom“ und „das reaktionäre Aufbegehren von Bürgern gegen die Anwendung der modernen Naturwissenschaft“ ein (Ebd., S.1). Sowie die „Sehnsucht nach einem Leben ohne solche Gefahren in Gestalt des Wunsches nach einem Staat, der durch den Verzicht auf die Entwicklung der Produktivkräfte den Interessen seiner Bürger entspricht“ (Ebd.).
Im Frühjahr 2011 verteilt der GSP ein Flugblatt mit der Überschrift „‚Atomkraft: Schluss!' Und dann ist Deutschland in Ordnung?“ Unterstellt wird, diejenigen, die sich gegen Atomkraft wenden, meinten, ohne Atomkraft sei Deutschland in Ordnung. Das Flugblatt suggeriert, man könne nicht gegen Atomkraft sein, wenn man nicht gegen „die Grundrechenarten, die diese Herrschaften mit den Völkern anzustellen pflegen“, eintritt (S. 1). Gezeigt wird nicht, warum dem Protest gegen die Atomkraft etwas fehlt, wenn er nicht Protest gegen den Kapitalismus ist. Suggeriert wird, Atomkraft sei im Kapitalismus notwendig. Argumente für diese These finden Leserinnen und Leser nicht.
Die westliche Aufrüstung gegen die Sowjetunion bildete eines der zentralen Themen ab Ende der 1970er bis zum Ende der 1980er Jahre. Die MG verbreitete in der Kritik an der „Nachrüstung“ und der Friedensbewegung die Fehleinschätzung „Der Westen will den Krieg“ (Held, Ebel 1983). Die damalige westliche Aufrüstungspolitik hatte nicht den Krieg, sondern das Totrüsten der SU zum Ziel. In der Wirtschaft der SU gab es neben dem in seiner Produktivität weit hinter westlichen Standards zurück liegenden zivilen Sektor einen militärisch-industriellen Sektor, der mit westlichen Standards durchaus konkurrenzfähig war.
Zwar herrschten im militärisch-industriellen Sektor wie im zivilen Sektor Vergeudung und Ineffizienz, es wurde ersterem nur im Unterschied zum zivilen Sektor ungleich mehr Ressourcen pro Produktionseinheit zugewiesen. Die sowjetische Führung leistete sich eine Militärproduktion zu ausserordentlich hohen Produktionskosten. Die Aufrüstungspolitik unter Reagan zielte darauf ab, die Sowjetunion noch stärker in einen Rüstungswettlauf zu verwickeln, der ihr verglichen mit den USA ein ungleich höheres Mass an Querfinanzierung aus dem zivilen Wirtschaftssektor abforderte und diesen schlussendlich überfordern musste. Als Zwischenergebnis halten wir fest: Sollte es „richtiges Wissen“ bei MG und GSP geben, so verhindert es jdf. nicht, dass MG und GSP bei wichtigen Auseinandersetzungen mit unschöner Regelmässigkeit brutal daneben liegen.
Zu dem Dogma, Alternativen zu Konkurrenz, Hierarchie und Privateigentum seien unpraktikabel, bildet der israelische Kibbuz ein lehrreiches Gegenbeispiel (vgl. Creydt 2005). Es zeigt: ‚Anders arbeiten – anders leben' ist möglich. Der Kibbuz war jahrzehntelang ein auf Gemeinschaftsbesitz und -leben und auf Gleichheit des realen Pro-Kopf-Einkommens orientiertes Projekt. Er stellte eine deutlich weniger hierarchisch strukturierte und auf Rotation möglichst vieler Personen auf Leitungspositionen orientierte Organisation dar. Beides führte nicht zu organisatorischem Chaos und nicht zu massiven Einbussen in puncto Produktion und Konsumtion.
Die Kibbuzim gelten seit Jahrzehnten als „die weltgrösste kommunitäre Bewegung“ (Feindgold-Studnik 2002, 35) mit einer erheblichen Beteiligung: 1949 gab es 63.500 Kibbuzmitglieder, 1966 81.900, 1986 127.000 (Busch-Lüty 1989, 36), 2001 127.000 (Feingold-Studnik 2002, 6). (Vgl. zur Entwicklung der Kibbuzim Lindenau 2007.) Mir ist nur ein Artikel von der Marxistischen Gruppe und dem GSP zu den israelischen Kibbuzim bekannt. Die Kibbuzim werden dort als „Wehrdörfer“, ihre Mitglieder als „Wehrbauern“ bezeichnet (MSZ 7/8 1985, 33). Aus e i n e r Eigenschaft einiger, nicht aller Kibbuzim, an der Grenze Israels zu liegen, macht der Artikel d a s die Kibbuzim i n s g e s a m t bestimmende Charakteristikum.
Zum Gemeinschaftsbesitz der Kibbuzmitglieder bemerkt der Artikel, es handele sich bei ihnen um „Idioten“ (ebd.), insofern sie auf Lohn verzichten würden. Die Autoren sind derart fixiert auf den bürgerlichen Materialismus, also darauf, für einen höheren Lohn des einzelnen Individuums einzutreten, den es dann im Erwerb von Waren und Dienstleistungen umsetzt, dass ihnen entgeht, wie das Kibbuz mit Gemeinschaftsbesitz und gemeinsamer Leitung ein besseres Leben der Menschen ermöglicht. Dass der Lebensstandard der Kibbuzim zwischen den 1960er und 1980er Jahren im Vergleich zu Erwerbstätigen mit ähnlichen Berufen in Israel höher lag, über diese Tatsache sieht der Artikel souverän hinweg.
Fehler in Bezug auf den „kategorischen Imperativ“
Beim kategorischen Imperativ handelt es sich um ein zentrales Theorem der Ethik. „Mit der Fassung dieses Imperativs ist Kant das wohl populärste Stück Philosophie überhaupt gelungen. Dieser Gedanke hat die Massen ergriffen – oder war es umgekehrt? Jedenfalls kann jeder bessere Politiker und Studienrat zitieren: ‚Handle stets so, dass du zugleich wollen kannst, dass die Maxime deiner Handlung allgemeines Gesetz werde'“ (GSP: Königsberger Klopse, 25).Nachdem die Autoren den Stellenwert des kategorischen Imperativs derart unterstrichen haben, ist der Leser überrascht über die erstaunlich uninformierte Aussage, mit der der Artikel fortfährt: „Wer nicht studiert hat, kennt den kategorischen Imperativ darum aber nicht schlechter, nur eben volkstümlich und gereimt: ‚Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg' auch keinem andern zu'“ (Ebd.). Der MG/GSP-Publizist Freerk Huisken schreibt: „‚Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.' ‚Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg' auch keinem anderen zu!', so lautet die populäre Fassung des Kant'schen Satzes“ (Huisken1992, 204).
Kant erläutert den Unterschied zwischen dieser sog. goldenen Regel und dem kategorischen Imperativ. Seine Kritik an ihr lautet: Sie „enthält nicht den Grund der Pflichten gegen sich selbst“ sowie der Pflichten gegen andere (Kant GMS, BA 68 Anm.). Dieser Grund besteht für Kant in der Maxime „Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchest“ (Kant, GMS, BA 66). Die goldene Regel hat für Kant ihre Grenze darin, dass manche(r) sie insofern aus dem Motiv für gut erachtet, „dass andere ihm nicht wohl tun sollen, wenn er es nur überhoben sein dürfte, ihnen Wohltaten zu erzeigen“ (Kant GMS, BA 68 Anm.). Die goldene Regel „ist eine bloss subjektive Regel, die erst objektiv werden könnte, wenn sie selbst noch durch eine andere Regel eingeschränkt würde. Denn, was ich wollen kann, das man mir tu, das muss noch lange nicht für andere gelten. Meine subjektiven Zwecke könnte ich nach der goldenen Regel anderen aufzwingen, nur weil andere sie bei mir realisieren. Auf die positive Variante bezogen, könnte ein Masochist z. B. verlangen, weil er Lust am Gequältwerden empfindet, dass sich auch andere quälen lassen“ (Gassmann 2001, 105).
Der oben zitierte GSP-Artikel fährt nach dem letzten aus ihm wiedergegebenen Zitat fort mit folgendem Satz: „Alle Schichten des Volkes aber schätzen die absolute Kurzfassung der probehalber verallgemeinerten Handlung: ‚Wenn das jeder täte!' Diese Moralprobe auf jede Handlung scheint so überzeugend zu sein, dass sich die Nachfrage ‚Was wäre dann?' allemal erübrigt“ (GSP Königsberger Klopse, S. 25).
Beim moralisch Guten im Sinne Kants und beim kategorischen Imperativ handelt es sich n i c h t um die Bewertung von Handlungen durch Vergegenwärtigung ihrer Folgen im Falle ihrer faktischen Verallgemeinerung, sondern um die Bewertung mit Blick auf die Maxime oder den Grundsatz, der der Handlung zugeordnet werden kann. Es kommt, „wenn vom moralischen Werte die Rede ist, nicht auf die Handlungen an, die man sieht, sondern auf jene inneren Prinzipien derselben, die man nicht sieht“ (Kant, GMS, BA 26). Und „das Wesentlich-Gute derselben (der Handlungen – Verf.) besteht in der Gesinnung“ (Ebd., BA 43).
Zur Beurteilung der Maxime der Handlung soll Kant zufolge z. B. beim Suizid nicht gefragt werden, was in dem Falle passieren würde, in dem alle diejenigen Menschen sich das Leben nehmen würden, die seiner überdrüssig werden. Vielmehr soll derjenige, der wissen will, „ob es auch nicht etwa der Pflicht gegen sich selbst zuwider sei, sich das Leben zu nehmen“, sich fragen, „ob die Maxime seiner Handlung wohl ein allgemeines Naturgesetz werden könne.“ Das von Kant durchexerzierte Gedankenexperiment prüft die Maxime darauf, ob sie vernünftig ist oder nicht.[4]
Das heisst für Kant zu fragen, ob sie Widersprüche enthält. Bspw. lautet die Maxime eines Suizidanten: „Ich mache es mir aus Selbstliebe zum Prinzip, wenn das Leben bei seiner längern Frist mehr Übel droht, als es Annehmlichkeit verspricht, es mir abzukürzen.“ Die Prüfung dieser Maxime auf Widersprüche fragt, „ob dieses Prinzip der Selbstliebe ein allgemeines Naturgesetz werden könne. Da sieht man aber bald, dass es eine Natur, deren Gesetz es wäre, durch dieselbe Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Beförderung des Lebens anzutreiben, das Leben selbst zu zerstören, ihr selbst widersprechen und also nicht als Natur, bestehen würde, mithin jene Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz stattfinden könne, und folglich dem obersten Prinzip aller Pflicht gänzlich widerstreite“ (Kant, GMS, BA 53f.).
Die Person, die Suizid begeht, komme Kant zufolge mit ihrem Lebensüberdruss in einen logischen Selbstwiderspruch. Die Unlustempfindungen weisen Kant zufolge materialiter (!) die Eigenschaft auf, „zur Beförderung des Lebens anzutreiben“ (Ebd.). Die Unlustempfindung des Hungers bspw. veranlasse den Menschen, sich zu sättigen und damit sein Leben zu fördern. Der Selbstmörder müsste als Maxime den Satz aufstellen: „Wenn ich Unlustempfindungen verspüre, bemühe ich mich, mein Leben zu beenden.“ Diese Maxime weise Kant zufolge den logischen Selbstwiderspruch auf, der Empfindung von Unlustempfindungen zwei widersprüchliche Folgen zuzuschreiben: Die Beförderung und die Zerstörung von Leben.
Der Selbstmörder bedient sich Kant zufolge „einer Person (und zwar sich selbst), bloss als eines Mittel eines zur Erhaltung eines erträglichen Zustandes bis zum Ende des Lebens“ (Kant, GMS, BA 66). Da der Mensch keine Sache sei, sei ich nicht befugt, über mich selbst als mir gehörende Sache zu verfügen, die ich zerstören darf. Dies aber müsste ich, um mich zu töten.
Was immer von diesen Argumenten zum Suizid und von der Unterstellung einer Funktionalität der Unlustempfindungen materialiter zu halten ist – das ist an dieser Stelle unerheblich. Vielmehr ist festzuhalten: Kant argumentiert – entgegen der Behauptung des GSP – nicht auf der Ebene von „‚Wenn das jeder täte!'“ (GSP Königsberger Klopse, S. 25). Bei beiden vom GSP vorgenommenen Gleichsetzungen des kategorischen Imperativs (erstens mit der goldenen Regel, zweitens mit der Folgenabschätzung bei empirischer Verallgemeinerung der jeweiligen Handlung) handelt es sich um Anfängerfehler. Jedes Philosophielehrbuch, das den kategorischen Imperativ darstellt, klärt über diese Missverständnisse auf.
Missverständnisse in Bezug auf die Grundrechte
Im Rahmen ihrer Kritik des bürgerlichen Staats unterscheiden MG und GSP nicht zwischen Grundrechten und Toleranz. Der absolutistische Staat gewährt z. B. im günstigen Fall religiöse Toleranz, im Rechtsstaat herrscht Religionsfreiheit. Der absolutistische Staat steht über dem Recht, die politische Führung im modernen bürgerlichen Staat ist an die Verfassung und die Gesetze gebunden. Dabei handelt es sich um einen Unterschied ums Ganze.Eine Toleranz wie die des Edikts von Nantes (1598) gegenüber den französischen Protestanten (Hugenotten) lässt sich aus (innen- oder aussenpolitischen) Opportunitätsgründen auch wieder entziehen (Edikt von Fontainebleau 1685). Anders verhält es sich mit den Menschenrechten in der bürgerlichen Gesellschaft. Sie enthalten juristische Vorgaben gegenüber der Regierung und den Behörden und einklagbare Rechte ihnen gegenüber. Dieser für die Entwicklung der Verfassung in den letzten 300 Jahren zentraler Unterschied existiert für MG und GSP nicht. In der immer noch verbreiteten Grundlagenschrift über „den bürgerlichen Staat“ (MG 1979) heisst es, „dass alle Freiheiten nur soweit reichen, wie der Staat es zulässt“ (22).
Der Schutz vor willkürlicher Verhaftung und Behandlung, das Recht auf Rechtsbeistand und ähnliche Grundrechte (also das Recht, Rechte zu haben) sind nicht zu über-, aber auch nicht zu unterschätzen. MG und GSP meinen, Recht sei etwas, das „der Staat“ als Supersubjekt der Gesellschaft (vgl. zur Kritik an dieser Vorstellung Creydt 2015, 62-75) erlaube.[5] Wer nun aber als Souverän etwas erlaube, könne es auch verbieten. Wer als Staat ein Recht gewähre, könne es auch entziehen.
„Im sonstigen Leben würde man es sofort merken, dass die Aussage ‚du darfst (weiter-)leben' die Infragestellung des Lebens beinhaltet; sie ergibt ja nur Sinn z. B. bei einem Mörder, der die Waffen sinken lässt, weil er es sich noch einmal anders überlegt hat. Nicht anders beim Staat: Wer so grosszügig daherkommt, dem sind die als Rechte aufgezählten elementaren Lebensäusserungen und sogar das Leben selbst weder egal noch selbstverständlich, sondern der hat die Macht, über sie zu verfügen“ (MG 1987, 20). (Auch diese Publikation wird wie alle anderen MG-Publikationen, aus denen dieser Artikel zitiert, vom GSP weiterhin vertrieben und beworben.) Die Konstruktion eines mit sich einigen Subjekts „der Staat“, das Souverän über das Recht sei, lässt bestimmte Phänomene verschwinden. Zum Beispiel die Möglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern, juristisch gegen bestimmte Entscheidungen staatlicher Behörden vorzugehen. Z. B. die Konflikte zwischen der Rechtssprechung (v. a. des Bundesverfassungsgerichts) und der Regierungspolitik.[6]
Die Verwechselung von „systemisch“ mit „systematisch“
Huisken macht die soziologische Redeweise von einem gesellschaftlichen „System“ zum Thema. Er konzediert: „Es muss kein Fehler sein, einer Sache System zu bescheinigen. Dazu ist allerdings zweierlei notwendig vorausgesetzt. Erstens muss man die Eigenart der Sache und ihrer Bestandteile ermittelt haben. Zweitens ist zu prüfen, ob sich daraus ein Bezug der Momente aufeinander ergibt, der einer Gesetzmässigkeit oder einem Prinzip folgt, das jene Momente dann systematisch ordnet“ (Huisken 1992, 185).Huisken verschiebt stillschweigend das Thema, er geht unter der Hand über von „systemisch“ zu „systematisch“. Beide sind nicht ein und dasselbe. Was systematisch heisst, erläutert Huisken im nächsten Satz: „So ist z. B. das Periodensystem der chemischen Elemente keine willkürliche Betrachtungsweise. Es ist tatsächlich die Eigenart jedes besonderen Elemente, dass mit der Protonen- und Massenzahl seines Atoms die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Stoffs festgelegt sind. Die zweite Entdeckung schliesslich, dass nämlich mit wachsender Massezahl bestimmte Eigenschaften periodisch wiederkehren, hat zu jener systematischen Anordnung der Elemente geführt, die sich nach der Ordnungszahl richtet und jedem Pennäler als Tafelbild aus dem Chemiesaal vertraut ist“ (Ebd., 185f.).
Mit „systemisch“ i. S. der Soziologie – das war der Ausgangspunkt von Huiskens Gedankenreise – hat das erkennbar nichts zu tun. (Eine umfassende Auseinandersetzung mit richtigen und falschen Argumenten bei MG und GSP zum Systembegriff in der Gesellschaftstheorie findet sich bei Creydt 2015, 75-83.) Huiskens Buch erschien im VSA-Verlag. Er veröffentlichte insgesamt zehn Bücher von Huisken sowie diverse Bände anderer GSP-Vortragsredner (Krölls, Dillmann u. a.). Kein Verlag sonst verbreitet so viele Titel, die voll auf GSP-Linie sind. Dabei haben sich MG und GSP nie anders als feindlich positioniert zu allen Inhalten, die für die anderen bei VSA verlegten Bücher sowie für die Zeitschrift „Sozialismus“ charakteristisch sind.
Schluss
Die zitierten Stellungnahmen von MG/GSP sprechen aus der Position des Wissenden ohne Wissen. Sie artikulieren einen Willen zur Kritik, der sich von der Erkenntnis des zu Kritisierenden emanzipiert. Bedient wird eine Haltung des Darüber-Stehens per kritischer Abfertigung. Und ein Durchblickertum, das einen Unterschied zum gewöhnlichen Alltagsverstand macht, indem es eine pseudokritische Distanz zum jeweiligen Thema ausstellt. Wer diese Herangehensweise attraktiv findet, gefällt sich daran, etwas sich vermeintlich geistig dadurch anzueignen, dass er oder sie einen kritischen Spruch zum jeweiligen Objekt aufzusagen weiss. Die implizite Maxime lautet: „Alles kritisieren, nichts studieren“. Die präsentierten Auffassungen vermögen wohl „zu be- und verurteilen, aber nicht zu begreifen“ (MEW 23, 528).Gravierende „Fehler“ in Stellungnahmen der Marxistischen Gruppe bzw. des Gegenstandpunkts bilden das Thema dieses Artikels. Die eigene Logik oder Ordnung der Auffassungen von MG und GSP ist ein anderes Thema. Sie haben einige ernst zu nehmende Argumentationen erarbeitet. Vgl. zur Analyse und Kritik Creydt 2015. Dieses Buch zeigt, dass sich die Auseinandersetzung mit ihnen lohnt. Allerdings finden sich in den Publikationen von MG und GSP auch nicht zu knapp massive Fehleinschätzungen. Dass dies nicht Nebensächlichkeiten betrifft, sondern relevante Themen, zeigen die besprochenen Beispiele.