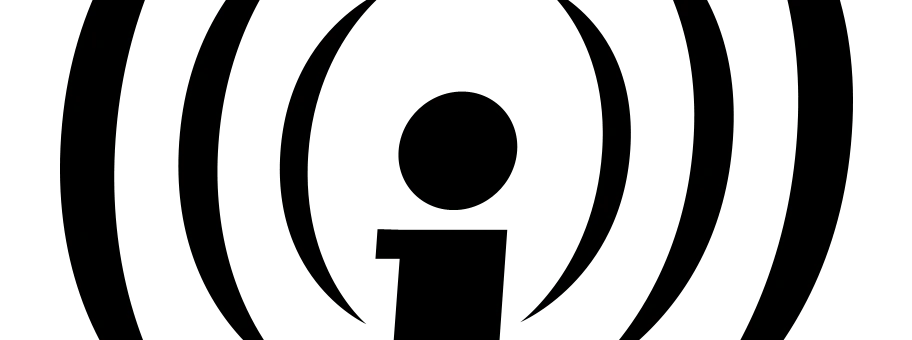„Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten.“ (https://twitter.com/akk/status/1133057501111496709)
„Wenn einflussreiche Journalisten oder #Youtuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur.“ (https://twitter.com/akk/status/1133057504236195840)
Die Querfront ihrer KritikerInnen
Vom Stellvertretenden Bundes- sowie Berliner Landesvorsitzenden der AfD Georg Pazderski[1] über- den FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner[2],
- den Stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden und Nordrhein-Westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet[3],
- die Ko-Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Katrin Göring-Eckardt[4],
- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil[5] und
- den verfassungspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion der Linkspartei Niema Movassat[6]
Diese Proteste sind immerhin besser als die deutsche Selbstgefälligkeit am Internationalen Tag der Pressefreiheit, die Letztere überall auf der Welt – von den USA bis Russland; von Venezuela bis Türkei – bedroht sah, nur in Deutschland nicht…[7]
Der blinde Fleck der KritikerInnen
Dabei geht aber – was mit Blick auf die Mitglieder dieser ganz breiten Volksfront nicht allzu überraschend ist – die Banalität unter, auf die aber wenigstens das Lower Class Magazine hinweist:„die Welt der Youtuber*innen und Influencer*innen [ist] ein Teil der Marketingmaschinerie, bei der es um das Propagieren und Verfestigen bestimmter Lebensstile und eines damit kompatiblen Konsumverhaltens geht. Da werden Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetika gepusht, Musiktitel oder alberne Challenges gehypt. Mit der grossen Politik hatte diese Welt bisher wenig zu tun – und das sollte sie sicher auch nicht.“ (https://lowerclassmag.com/2019/05/29/die-cdu-die-jugend-und-das-internet/)
Nun gilt die Meinungsäusserungsfreiheit – ganz zurecht – auch für PR-AgentInnen und -Maskottchen; und Kosmetika zu bewerben, ist sicherlich nicht ehrenrühriger als PKW zu bauen. Aber Fragen nach der Verquickung von Meinung und Geschäft; von politischer Meinung und Marken-Image[8] in der internet-Ökonomie; Forderungen nach einer klaren Unterscheidung von Werbung und redaktionellen Beiträgen sowie transparenter Parteienfinanzierung auch im Internet bzw. bei Internet-Werbung sind berechtigt. Dafür braucht es nicht einmal besonders viel ‚Unterklassen'-Bewusstsein oder gar Marxismus. Vielmehr sollten sich diesbezüglich auch Kartellämter und VerbraucherschützerInnen aufgeschlossen zeigen.
Die Grenze
- gerade von der Offenhaltung und Transparenz eines – auch in grundlegenden Fragen – kontroversen Meinungsbildungs- und Diskussionsprozesse durch formale (d.h.: inhalts-indifferente) Fristen- und Kennzeichnungs-Normen
- zur inhaltlichen Monopolisierung der Meinungsbildung durch die selbsternannte „Mitte“ ist allerdings dann überschritten, wenn der Staat (einschliesslichen dessen Gerichte) machtvoll definiert, ++ was ethisch[9] und ‚kulturvoll' (s. AKKs Rede von „politische[r] Kultur“); ++ was (gerade noch) berechtigte (‚mittige') und was unberechtigt (‚extremistische' oder „radikale“ [AKK[10]]) Meinungsäusserungen sind – statt gerade dies dem (zivil)gesellschaftlichen Streit zu überlassen[11].
Der Fall linksunten.indymedia
Angesichts der jetzigen Proteste gegen etwaig von AKK beabsichtigte Einschränkungen der Meinungsäusserungsfreiheit ist erneut darauf hinzuweisen: „Die Zensur findet längst statt“ (Nowak/Schill/Schulze 2019a): Kurz nach den Protesten während des G20-Gipfels in Hamburg verbot das Bundesinnenministerium unter Leitung von Thomas de Maizière mit Verfügung vom [14]. August 2017 die linke Internet-Zeitung linksunten.indymedia. Das Verbot wurde rund zehn Tage später – begleitet von mehreren Haussuchungen in Freiburg – bekannt gemacht. Seit fast zwei Jahren ist linksunten nun von Rechts wegen am Erscheinen gehindert – egal, was für Inhalte es veröffentlichen möchte, denn eine Gerichtsentscheidung über das Verbot steht weiterhin aus[15].Das Mittel, das dieses Verbot rechtmässig machen soll, war, linksunten.indymedia kurzerhand zu einem Verein zu erklären – und dann Artikel [9] Absatz [1] Grundgesetz (Vereinigungsfreiheit) und dessen Schranke (Vereinigungsverbot) im dortigen Absatz [2] an Stelle des in Wirklichkeit einschlägigen Artikel [5] Absatz [1] und [2] (Meinungsäusserungs- und Medienfreiheiten und deren Schranken sowie Zensurverbot) anzuwenden.
Die Antwort, die Stefan Kuzmany bei Spiegel Online auf AKKs Frage, „was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich, und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich“, gab, ist auch eine Antwort auf das Vereins-Konstrukt, mit dem das Bundesinnenministerium im Fall „linksunten“ versucht, die Pressefreiheit und das Zensurverbot auszuhebeln: Die Regel, die „analog und digital“, „für Redaktionen, YouTuber und auch für alle anderen“ gilt, „steht im Artikel [5] unseres jüngst gefeierten Grundgesetzes: Die Verfassung garantiert das Recht eines jeden, ‚seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äussern und zu verbreiten'. Selbstverständlich kann das auch bedeuten, dass sich zwei, drei, dreissig oder dreihundert Menschen in freier Entscheidung zusammentun und gemeinsam“ Meinungen äussern und/oder berichten. (https://www.spiegel.de/politik/deutschland/annegret-kramp-karrenbauer-die-selbstzerstoerung-der-akk-a-1269632.html)
Internet-Medien als „kollektive OrganisatorInnen“?
Das Lower Class Magazine artikuliert in oben genanntem Artikel die Hoffnung: „Rezos Video ist nach Friday's for Future ein zweiter überraschend erfolgreicher Vorstoss junger Leute in den politischen Raum. Man muss nicht gleich eine neue Jugendbewegung ausrufen, aber es ist natürlich erfreulich, wenn Jugendliche anpolitisiert werden, weil sie so zumindest potentiell aufnahmefähig für radikale Systemkritik werden“,und setzt dann noch folgenden skeptischen Schlusssatz hinterher:
„Bloss sollte niemand den Fehler machen, die Fähigkeiten des Systems zu unterschätzen, Protest und Widerstand einzudämmen und einzugemeinden.“
Sowohl Hoffnung als auch Skepsis in allen Ehren – nur scheint uns zunächst einmal ein grundlegender Unterschied zwischen einer Demonstration (Fridays for Future oder anderen) und dem Ansehen eines Filmbeitrages (sei es früher im analogen Fernsehen oder heute in einem YouTube- oder anderen digitalen Kanal) zu bestehen: Zwar beweist das Rezo-Video, dass eine ‚kritische' Meinung ein breites Publikum finden kann, aber die [10] Millionen ‚Klicker' und ‚Klickerinnen' sitzen trotzdem allein von ihrem Computer-Monitor und bilden daher keine ‚kritische Masse'16, sondern weiterhin eine amorphe.
Auch im internet-Zeitalter steht daher unseres Erachtens weiterhin die klassische leninsche Frage: (Wie) kann eine Zeitung (oder ein anderes Medium) ein kollektiver Organisator sein?17
Auch wenn es sich bei linksunten nun nicht gerade um eine leninistische Zeitung handelte, so führt uns die gerade angeführte klassische leninsche Frage noch einmal von Rezo zurück zur verbotenen Internet-Zeitung linksunten.
Auch,
- wenn eine internet-Zeitung bei weitem nicht den komplexen Distributionsapparat benötigt, den eine gedruckte Zeitung – und zumal eine klandestin produzierte und vertriebene gedruckte Zeitung – erforderte und woran Lenin zu einem erhebliche Teil seiner Hoffnungen auf die organisierende Wirkung der Zeitungsproduktion knüpfte, und
- wenn mit linksunten auch gar nicht der Anspruch eines Organisationsaufbaus verbunden war (weshalb das vom Bundesinnenministerium verfügte „Vereins“verbot auch aus diesem Grunde ein schlechter Witz ist),
Kollektive Debatten in Zeiten von Neoliberalismus18, Digitalisierung und ‚social' media
„Brecht […] ging es […] um strukturierte gemeinsame Arbeit […]. Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen der Kooperation ist freilich, dass ein soziales Netzwerk von Zusammenarbeitenden entsteht; dass es ihnen gelingt, sich ‚in Beziehung zu setzen'.“Mautpreller 2012, 38
„Filterblasen“ hin oder her – die einzelnen linksradikalen und revolutionären Accounts gehen bei Facebook und Twitter zunächst einmal in einer Masse von Mainstream unter; dito linke Inhalte unter Suchergebnissen – und tendenziell ebenfalls dito in Bezug auf mit bestimmten Hashtags verknüpften posts (jeder Hashtag kann pro und contra kommentiert und so ‚gekapert' werden) –, und die einzelnen NutzerInnen müssen sich ihre je individuellen „Filterblasen“ erst einmal zusammensuchen.Manche mögen traditionelle Medien (private Zeitungen und Zeitschriften; öffentlich-rechtliche und private Fernseh- und Radiosender) eh auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit sehen. Wir sind uns dagegen weder dieser Prognose sicher; noch sind wir uns sicher, dass eine solche Entwicklung wünschenswert wäre.19 Daher kommt für uns ein weiteres Argument hinzu:
- linksunten wurde ab und an mal von professionellen Medien erwähnt – sei es wegen Anschlagserklärungen oder wegen Antifa-Recherchen – und damit auch einigen Leuten bekannt, die mit linker Szene zunächst einmal nichts zu tun haben. [Und manche dieser Erwähnungen wurden auch bei Facebook und Twitter verlinkt und bei Google-Suchergebnissen angezeigt.]
- Aber wann wird einmal ein einzelner linksradikaler oder revolutionärer Facebook- oder Twitter-Account oder eine einzelne solche Webseite in professionellen Medien erwähnt?
- bei dem linke Inhalte nicht in einer Masse von Mainstream untergehen, sondern ein linker Minimalkonsens20 als Grundlage gegeben ist;
- wo die Reihenfolge der Anzeige von Suchergebnissen nicht von den Algorithmen von Facebook, Twitter und Google abhängt;
- wo es neben einer chronologischen Timeline ein – mit linken Begriffen gebildetes – Kategoriensystem gibt;
- wo die LeserInnen nicht mit der Werbung behelligt werden, mit der Internetkonzerne ihr Geld verdienen;
- wo wir nicht mindestens die Daten, die sich aus unserem Nutzungsverhalten ergeben, den Konzernen für Profilbildung schenken;
- wo nicht nur Links abgeworfen werden, die dann zu Texten in wiederum vereinzelten Blogs und Webseiten von kleinen Gruppen und Einzelpersonen führen, sondern tatsächlich Texte zur Verfügung und diskutierbar neben einander stehen
- wo auch die militante Linke integraler Teil der Debatte ist21.
Bleibt die Frage: Ist dies unter den heutigen technologischen und ökonomischen Bedingungen24 ein Ideal jenseits von Zeit und Raum, oder hat dies weiterhin Realisierungschancen, und ist es politisch gewollt?