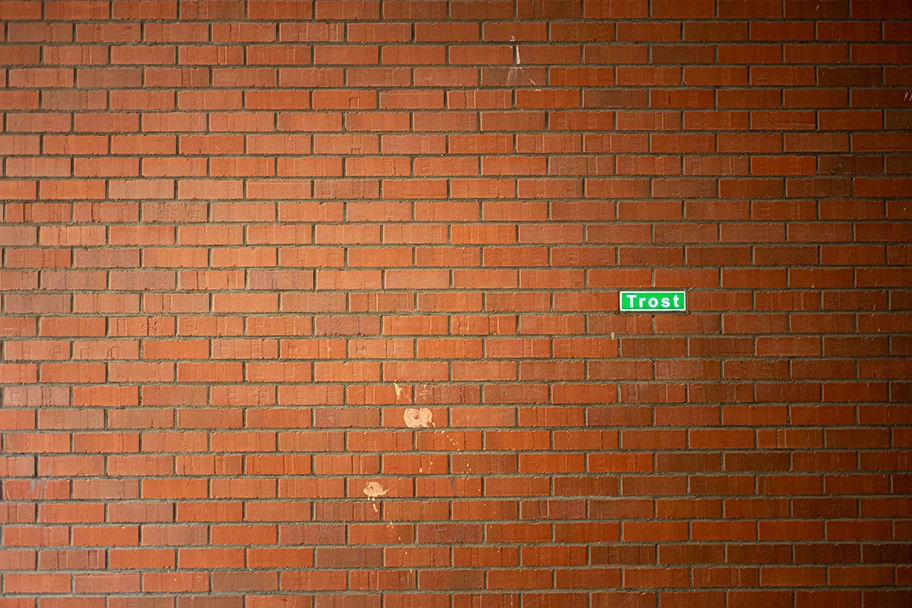Ich meine die gesellschaftliche Herstellung oder soziale Konstruktion von Krankheit / Gesundheit auch mittels sozialer Leit-Bilder, Images, Wertvorstellungen — also das, was Dieter Lenzen ganz brillant am gesellschaftlichen Paradigma 'Krankheit' und ihm folgend ,Medizin' unter dem Stichwort „Krankheit als Erfindung“[1] erinnert. Diese Perspektive findet sich in meiner kleinen sozialmedizinischen Studie[2] noch nicht. Und sie findet sich ebensowenig in einem aus medizinischer Sicht gewiss nützlichen, aber eben auch in der zweiten Auflage hier nicht weiterentwickelten Lehrbuch zur Sozialmedizin.[3]
1. Zur Kritik des sozial-medizinischen Krankheitskonzepts
Dies — so meine ich — ist in der Tat die zu überwindende Grenze, die letztendlich und bis heute das, was Schul-Medizin genannt werden könnte und selbstverständlich auch historisch fortschrittlich war (insbesondere im Feld Hygiene/Seuchenbekämpfung bis hin zu Rudolf Virchows Thematisierung sozialer Noxen Mitte des 19. Jahrhunderts) und aktuell einen, freilich immer geringer werdenden Teil, unseres Krankheitspanoramas an der Schwelle zum 21. Jahrhundert therapieren kann, ausmacht: Nämlich die immer noch dominante Ausblendung der sozio-kulturellen Dimension als zentrale Basis der Erscheinungen, die sozial als Krankheiten definiert werden.Am Beispiel und konkret gesprochen: A uch in Heiko Wallers systematisch-ausgreifender und informativ-anregender Einführung wird das dominante medizinische Paradigma weder kritisch aufgearbeitet noch überwunden. Insofern ist's in der Tat Sozial-Medizin. Deren Ausgangspunkt ist immer noch der homo morbidus. Mein salutogenetisch-gesundheitswissenschaftlicher Ansatz hingegen geht vom homo salugens, vom „gesunden“ Menschen, aus Der Autor geht wohl vom Allgemeinen zum Besonderen, führt in seine Zentralfelder: Gesundheit — Krankheit — Behinderung kundig ein, präsentiert sozialepidemiologische Gesundbefindlichkeiten, gibt einen Abriss über das deutsche Gesundheitswesen und seine Klienten („Patienten“) in ihren Einrichtungen und leitet nach Hinweisen auf sozialmedizinische Praxis auf Besonderungen hin: Nämlich — erstens — körperliche Erkrankungen (Herzkreislauf; Krebs; HIV-positiv/AIDS), sodann — zweitens — Behinderungen, beide Kapitel systematisch durchgegliedert in a) medizinische, b) sozialmedizinische Grundlagen und c) sozialmedizinische Praxis. Im Schlusskapitel geht es dann um seelische Probleme, die als „psychische Störungen“ vorgestellt werden einerseits und um Suchtphänomene, vom Autor „Suchtkrankheiten“ genannt, andererseits, jeweils im Dreischritt: a) Psychiatrische Grundlagen, b) Sozialpsychiatrische Grundlagen, c) Sozialpsychiatrische Praxis.
Was freilich hier als spezielle Sozial-Medizin angeboten wird, halte ich für doppelt verengt: Einmal — um, weil die Wahrheit immer noch konkret ist, bei unseren legalen Drogen, Stimulantien und Anregungsmittel wie Alkohol und Nikotin als weitverbreitete Hauptmedien, die süchtig machen können, zu bleiben — einmal also mit Blick auf das, was nicht angesprochen wird. Meines Erachtens ist es schlicht untragbar und auch bedeutsame Bemühungen gesundheitsbewusster, sozialepidemiologischer Grundtatbestände berücksichtigender initiativer (Sozial-) Mediziner missachtend, nicht auf den mit Nikotin einhergehenden gesundheitlichen Gefährdungskomplex einzugehen.[4] Denn auch hier handelt es sich in Form von Rauchen einerseits, Nikotinabusus andererseits genannten Stoffzuführungen um gesundheitliche Schädigungsprozesse, die besonders mit ökologischen und Schadstoffbelastungen kumulativ destruktiv wirksam werden ... und zwar unabhängig davon, ob sich aus stoffgebundenen Rauchgewohnheiten Abhängigkeiten oder gar Suchtphänomene entwickeln.
Und auch wenn ich im Feld sowohl legalisierter als auch stoffbezogener Mittel bleibe, die durch gewohnheitliche Einnahme sei's abhängig sei's süchtig machen können, gibt es eine zweite, eher gegenständliche Kritikdimension: Denn auch das, was Heiko Waller als „spezielle Sozialmedizin“ vorstellt, geht im Kern über bekannte schulmedizinische Grundkenntnisse eben nicht hinaus. Natürlich sind „körperliche Folgen“ von Alkoholabhängigkeit lange schon bekannt. Und sicherlich wirkt Alkohol als Abhängigkeits- und Suchtpotential in Gestalt „schwerer Schädigungen der Leber, des Herzens und der Bauchspeicheldrüse, Gehirnschäden (...), verminderte Leistungsfähigkeit, Depressionen.“[5] Das freilich weiss nun jeder Allgemeinpraktiker.[6]
Weniger bekannt hingegen und auch vom Autor als Sozial-Mediziner nicht aufgeklärt ist der meines Erachtens alle Suchtphänomene und ihre Therapie beeinflussende sozial-konstruktive Zusammenhang. Genauer: gerade am Krankheitskonzept von Alkohol(ismus) lässt sich veranschaulichen, welche konfuse Subsumtionslogik in der deutschen Reichsversicherungsordnung herrscht. Erscheint zunächst nämlich Kontrollverlust — als personal nicht mehr abzuleistende soziale Kompetenzen und Handlungsmöglickeiten — als das distinkte Merkmal, auch im Sinne des nordrhein-westfälischen Psychiatriegesetzes etwa: bei Selbst- und Fremdgefährdung erfolgt per legem Einweisung / Therapeutisierung, so erweist sich dieses Konstitutionslement gerade im Krankheitskonzept von Jellinek als weder hinreichend noch notwendig, um als alkoholkrank zu gelten.
Es entspricht vielmehr dem äusseren Erscheinungsbild eines bestimmten Abhängigkeitstyps — gleichsam phänomenologisch plausibel —, ist aber gerade aus avancierter sozial-medizinischer Sicht unscharf. Hingegen gilt: Wenn „der Alkohol zum einzigen, ständig handhabbaren und verfügbaren Beziehungsobjekt“ wird, dann geht es auch aus der Sicht einer kultur-analytischen Sozialpsychologie um Suchterscheinungen. Hier würde es sich, und dies auch zum alltagspraktisch leicht erkennbaren Unterschied etwa zu Nikotinikern, im Sinne Jellineks um Alkoholiker-Typen, also „Alkoholiker mit Kontrollverlust“ handeln.[7] Dies freilich ist auch deshalb ein nicht hinreichendes Differenzierungsmoment, weil auch kontrollierte Alkoholkonsumenten als vergewohnheitliche Spiegeltrinker mit ihrer Unfähigkeit, „trocken“ zu leben, im Sinne der deutschen RVO als „krank“ gelten (sog. Delta-Trinker-Typen).
Dem alltäglichen Krankheitsbild freilich entspricht wesenhaft vor allem der enthemmte Trinker. Entscheidend erscheint also Kontrollverlust. Und dieses Trinker-Bild oder Image eines abhängigen Menschen gibt das sozialmedizinische Lehrbuch von Heiko Waller wieder. Dieser Autor scheint, als lehrender Sozialmediziner, tatsächlich nicht zu wissen, dass es (so Wolf- Dieter Rost ganz prägnant) „viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die ihre Arbeitsfähigkeit über Jahre nur dadurch aufrechterhalten, dass sie sich permanent mit einer gewissen Dosis von Alkohol betäuben, während sie nüchtern an ihrer Arbeits- und Lebenssituation scheitern müssten“. Diese Pegeltrinker ohne Kontrollverlust' (Jellineks Delta-Trinker-Typen) regeln etwa ihr berufliches „Funktionieren durch einen ständigen Alkohollevel“. Dies nun meint handlungswissenschaftlich, „dass hier die Droge nicht einfach entzogen werden kann, ohne einen Ersatz für ihre Funktion zu bieten bzw. ohne die Lebensumstände zu ändern“. So gesehen, muss theoretisch bedacht werden — auch wenn's liebgewonnene Selbstgewissheiten anzweifelt —, dass „Alkohol oder Drogen als Selbstheilungsmittel zu einer Verstärkung des Reizschutzes eingesetzt“ werden, mit dessen Hilfe sich auch „ein potentiell gesundes Individuum gegen eine real unerträgliche, unbewältigbare Lebenssituation schützt.“[8] Praktisch meint diese theoretische Überlegung im allgemeinen, sich die wirklichen Lebensumstände wirklicher Menschen genau(er) anzuschauen.[9] Und im besonderen wäre — so auch ähnlich Dieter Henkel auf dem baden-württembergischen Symposium „Suchtforschung: Sozialwissenschaftliche Perspektiven“ (4. 4. 1995)[10] — weiter genau(er) zu beobachten und zu erfahren, wer wann wie warum und was im Feld stoffgebundener Suchtmittel einnimmt.
Als hätte der Autor seinen engagierten Beitrag zu ethnologischen, epidemiologischen und interpretativen Aspekten des Zusammenhangs von Erwerbslosigkeit und suchthaftem Alkoholtrinken („drogenhafte Alkoholmuster“ nennt Dieter Henkel diesen Zusammenhang) erarbeitet, um's skizzierter Sozialmedizin paradigmatisch mal zu zeigen, spricht der akademische Sozialtherapeuth Henkel auch von der „subjektiven Sinnhaftigkeit des Alkohols als Droge“ speziell in dieser besonderen sozialen Gruppe.
Indem der Autor analytisch sowohl von der Bedeutsamkeit von (bezahlter Erwerbs-) Arbeit „für die Herausbildung von Alkoholgefährdungen und Alkoholabhängigkeiten“ ausgeht als auch „das Dogma der Abstinenz als primäres Therapieziel“ nicht teilen will, weil er um die „doppelte Problemlage vieler (besonders langzeitlich erwerbsloser) Patienten, nämlich alkoholabhängig u n d arbeitslos zu sein“
Dieter Henkel unterscheidet in seinem subjektwissenschaftlichen Zugriff[11] „zwischen dem drogenhaften, zur Beeinflussung persönlicher Probleme praktizierten Alkoholkonsum einerseits und dem nicht-drogenhaften, dem sogenannten konvivialen, zum allgemeinen gesellschaftlichen Lebensstil gehörenden, in kulturelle Traditionen und soziale Rituale (z.B. in Mahlzeiten, gesellige Feste) eingebundenen Alkoholkonsum andererseits, der aber in somatischer Hinsicht potentiell pathogen und ebenso in bestimmten sozialen Kontexten (z.B. im Strassenverkehr) riskant sein kann.“[12] Und gerade weil die platte Medienformel ,Arbeitslosigkeit macht alkoholkrank' "empirisch unhaltbar und theoretisch unsinnig“ ist — geht es Dieter Henkel um das besondere Risiko, dem (vor allem Langzeit-) Erwerbslose unterliegen: Nämlich alkoholabhängig zu werden und dies auch (etwa bei Wiederbeschäftigung) zu bleiben. Speziell zur sozialen Lage Erwerbslosigkeit und ihrer subjekttypischen Bedeutung führt der Autor zur „Spezifik der Arbeitslosigkeit“ aus:
„Zum einen ruft sie gerade solche psychosozialen Probleme und auch häufig in gebündelter Form hervor, die (...) generell bedeutsame drogenhafte A1koholmotive darstellen, z.B. Einsamkeit und Monotonie, Lebensleere und Perspektivlosigkeit, Angst und psychovegetatives Unwohlsein sowie Gefühle, nutzlos, wertlos und machtlos zu sein. Zum anderen schwächt und reduziert die Arbeitslosigkeit zugleich die Ressourcen zu deren Bewältigung erheblich. Denn die Arbeitslosigkeit ist eine Lebenslage, die vor allem durch Deprivation charakterisiert ist, nicht nur in ökonomischer, sondern vor allem auch sozialer und psychischer Hinsicht.
Hinzu kommen weitere Charakteristika. So z.B. der Ort, an dem sich Alkoholprobleme entwickeln und Abhängigkeiten verschärfen, ist bei Arbeitslosen weitaus häufiger als bei Berufstätigen nicht die Öffentlichkeit (z.B. der Arbeitsplatz oder die Gaststätte), sondern das eigene Zuhause. Man kann daher von einer arbeitslosigkeitbedingten Privatisierung des Suchtprozesses sprechen, die den Suchtprozess selbst in der Regel fordert und beschleunigt (...). Zugespitzt formuliert: Die Vergesellschaftung des Trinkens, die beim konvivialen Konsum riskante Formen und Folgen hervorbringen kann, ist beim drogenhaften Alkoholgebrauch ein präventives Moment, das mit der Arbeitslosigkeit oft zusammenbricht." Subjektwissenschaftlich erkennt Dieter Henkel die subjektive Sinnhaftigkeit des Alkohols als Droge speziell für sozial desintegrierte, zunehmend isoliert-vereinzelte und langzeitlich Erwerbslose: Alkohol also als „ein Mittel, sich gegenüber der leidvollen Virulenz der Probleme und unerfüllbaren Bedürfnisse zu immunisieren bzw. sich die Befriedigung zentraler Lebensbedürfnisse wenigstens partiell und zeitweilig zu verschaffen, längerfristig gesehen jedoch kann der Drogengebrauch des Alkohols - zunächst Folge der Arbeitslosigkeit - zum dominierenden Handlungsmuster im Alltag und damit zur Ursache dafür werden, dass die Überwindung der Arbeitslosigkeit nur schwer gelingt oder auch ganz fehlschlägt (...).
Objektiv gesehen handelt es sich beim drogenhaften Gebrauch des Alkohols um einen Prozess resignativer und regressiver Realitätsabkehr, der die Probleme der so handelnden Arbeitslosen auf Dauer auch eher verschärft und damit selbst die Voraussetzungen für seine Chronifizierung schafft, weil der Drogengebrauch des Alkohols auch bei Arbeitslosen nie in einem sozialfreien Raum stattfindet, sondern häufig Diskriminierungen und negative Etikettierungen (...) provoziert, die die Karriere zum Alkoholiker eher begünstigen als hemmen.“[13]
2. „Sinnzusammenhang“ als zentrales Leitkonzept im neuen gesundheitswissenschaftlichen Bewältigungsmodell
Wer sich auch nur ein wenig in der zeitgenössischen Wissenschaftsgeschichte verschiedener Disziplinen auskennt, weiss: Nicht selten braucht ein Paradigmenwechsel inkubativ lange. Auch wenn das Ergebnis, gleichsam resultathaft, später scheinbar als blosse Umkehrung alter Leitfragen erscheint: Etwa im Bereich der Medien(wirkungs)forschung in Form der Ablöse der forschungsleitenden Frage, was denn nicht mehr Medien mit Menschen - sondern was Menschen mit Medien „machen“.Auf den ersten Blick ähnlich stellt sich das namentlich von Aaron Antonovsky zuerst in seinem Buch (1979) über Gesundheit, Stress und Bewältigungshandeln präsentierte, recht vielschichtig angelegte, „salutogenetische“, also gesundheitsbezogene, Denk-, Wirksamkeits- und Handlungsmodell dar. Klaus Hurrelmann, selbst engagierter akademischer (Sozial-) Pädagoge und produktiver Handlungsforscher in Deutschland, hat, wenngleich ohne den Bruch etwa mit sozial-medizinischen Krankheitsbildern gänzlich zu verdeutlichen, völlig zu Recht die neue Qualität der Leitfrage von Antonovsky betont: "Die zentrale Frage“ - so Hurrelmann - „seines Ansatzes ist nicht nur, wie Krankheiten und Fehlentwicklungen zustande kommen, sondern auch, wie es Individuen schaffen, gesund zu bleiben und keine Auffälligkeiten oder Krankheiten zu zeigen. Zugespitzt gefragt: Wie schaffen es Menschen, angesichts der Vielzahl von krankheitserregenden, psychisch irritierenden und sozial frustrierenden Faktoren, die Lebensbewältigung im mikrobiologischen, biochemischen, physikalischen, psychologischen, sozialen und kulturellen Bereich ihrer Entwicklung aufrechtzuerhalten?“[14]
Dies ist schon die neue Leitfrage: Warum gehen Menschen nicht unter — obgleich alle Anzeichen kundigen Beobachtern sagen — sie müssten's?
In der Form, diese gesundheitswissenschaftlich zentrale Frage als Problemkomplex zu strukturieren, verzichtet Aaron Antonovsky - und dies macht die Bedeutsamkeit seines ,salutogenetischen' Ansatzes aus - auf alle wie auch immer: sei's biologisch, sei's neurophysiologisch, sei's individualpsychologisch ausgerichteten reduktionistischen Handlungsmodelle mit ihren unterliegenden simplen Input-Output-Wechselwirkungsideologien. Und geht von einem komplexen Subjekt-Objekt vermittelnden Menschenbild aus, das mit Hilfe der Schlüsselmetapher „sense of coherence“, also etwa „Sinnzusammenhang“, bewusst auf subjektive Handlungsstrukturen von sei's produktiv sei's destruktiv Wirklichkeit aneignenden und diese und sich verändernden Akteuren verweist - ohne jedoch Societät ins Subjekt zu verlagern und ohne damit soziale Rahmenbedingungen auszuklammern.
Dies macht, etwa wenn die Leitfrage auch kultur- und handlungssoziologisch ernst genommen würde, eben das nachhaltig neue Moment im zu verallgemeinernden Konzept ,social vulnerability' aus: Denn warum Menschen / Gruppen unter vergleichbaren ,objektiven' Lebensbedingungen (re-)agieren und manche „krank“ werden, andere „gesund“ bleiben: Genau dies ist als explandum theoretisch-modellhaft zu erfassen und empirisch-praktisch zu erkunden. Und indem der inzwischen an der israelischen Ben-Gurion-Universität von einem Lehrstuhl für Medizin-Soziologie aus weiter forschende und publizierende Autor empirisch auf letztlich Verstehen als Gesundheitsquelle und theoretisch auf die Bedeutung subjektiver Sozialstrukturen aufmerksam machen konnte — das hängt meines Erachtens eben mit einer speziellen Annäherung an ,social problems' der bis in die sechziger Jahre fortexistierenden, von soziologischen Kirchenvätern wie Park und Thomas begründeten, sozialwissenschaftlichen ,Chicago-School' zusammen: Denn diese hatte immer schon aus einer Minderheitenlage („marginal man“) Vermittlungsversuche zwischen differenten sozialen Welten abzuleisten — was soweit ging, dass sich die engagierten Sozialforscher oft als "professional stranger“, als Wanderer zwischen gesellschaftlichen Milieus, selbstverstanden. Und vor allem: Diese Schwebelage, etwa zugleich insider und outsider, also gleichzeitig drinnen und draussen, zu sein, als Wissenschaftler produktiv nutzen konnten.
Und genauso - ich gehe jetzt auf die Herausbildung des ,salutogenetischen' Paradigmas von Aaron Antonovsky ein, bevor ich es im Anschluss an Klaus Hurrelmanns deutschsprachige Kurzfassung vorstelle — so also begann die Wissenschaftsgeschichte des neuen Ansatzes: Von Haus aus Soziologe der ,New Chicago School', versuchte der Autor zunächst in seiner unpublizierten Dissertation (Ph. D.-Thesis: "The Ideologies of American Jews: A Study in Definitions of Marginal Situations“) bereits 1955, das ihm zu individualisiert erscheinende Konzept von Marginalität („marginal man“ im Sinne von Robert E. Park und später Everett V. Slonequist, auch sie US-Irnmigranten) um die von William I. Thomas wissenschaftlich entwickelte Dimension der ,social situation' zu erweitern. Wobei Antonovsky dazu empirisch auf Interviews mit jüdischen Einwanderern aus New Haven (1953) illustrativ zurückgreift.[15]
Nach Auswanderung in den israelischen Staat (1960) ging es Aaron Antonovsky dann um konkrete medizinsoziologisch-epidemiologisch-empirische Fall-Studien, die sich freilich bald schon um Zusammenhange wie: „Lebenskrisen“ oder „Gesundheit und Armut“ zentrierten. Der wenn man so will erste Schritt zum neuen Paradigma im Sinne einer konzeptionell ausgewiesenen Gesundheitswissenschaft findet sich dann (1972) in einem programmatischen Beitrag Aaron Antonovskys: Hier skizziert der Autor ein mehrdimensionales Modell, welches nicht mehr Krankheit im herkömmlichen Sinn, sondern Morbiditat, die unter bestimmten, angebbaren Bedingungen zum Zusammenbruch von Menschen führen kann, interessiert". Ohne hier auf auch in methodisch-pohabilistischer Hinsicht anregende Typenbildungen eingehen zu können — hier ist erstmals eine multifaktorielle Empirie mit einem komplexen multidimensionalen Modell verknüpft und meines Erachtens richtungsweisend präsentiert Worden“. Insofern finde ich in nuce schon den später Salutogenetik konstituierenden Leitgedanken des non-breakdown und damit, indirekt wenigstens, für Nicht-Verletzlichkeit und „resistanee“ als Element von Bewältigungshandeln und Überlebensressource.
Im Übrigen war es im Zusammenhang mit seinem Konzept des Zusammenbruchs Aaron Antonousky, der in diesem Zusammenhang auf das realempirische Kontinuum Krankheit - Gesundheit aufmerksam machte und der betonte, dass schon ein auf zwei Dimensionen verkürztes Gesundheitsverständnis (nämlich: a) weder Behinderung noch b) ärztlicher Befund/ärztliche Behandlung) eben alltagspraktisch minoritär und damit abstrakt-ideologisches soziales Leitbild ist. Und es sind gerade diese beiden nachhaltigen Akzentuierungen - nämlich einmal auf fliessenden Grenzen zwischen ,Kranken' und ,Gesunden' auch konzeptuell bestehen und zum anderen auch das Möglichkeitsspektrum ins Handlungsmodell einbeziehen[20] - die Aaron Antonovskys salutogenetischen Ansatz sowohl gesundheitswissenschaftlich als auch für anthropologisch arbeitende Psychiatrie so attraktiv macht.[21]
Im beanspruchten Zusammenhang besonders der Herausbildung von Salutogenetik als handlungsbezogenem gesundheitswissenschaftlichem Paradigma scheinen mir zumindest zwei bisher auch von seinen verdienstvollen Popularisatoren unbeachtete Beiträge Aaron Antonovskys bedeutsam: Einmal die selbstbewusste Präsentation des neuen Konzepts „sense of coherence“[22] — und, zum anderen, die erneute Akzentuierung der humanen Fähigkeit zu Sinngebung und aktivem Bewältigungshandeln im nun letztlich positiv gewendetem Konzept von „stay-well“[23] trotz alledem, was es halt alltäglich an Bedrohlichkeiten und Gefährdungen unserer conditio humana so gibt ...
Dabei unterliegt ein Gleichgewichts oder Balance-Modell (vom Autor Homeostatasis, also etwa: Sich-Im-Gleichgewicht-Befinden genannt). Zu dessen Herstellung der gesundheitsbezogene Ansatz des ,Sinnzusammenhangs' nötig ist — und zwar besonders im Sinne von Vertrauen und sozialer Verlässlichkeit durch Akteure und nicht zuletzt auf Funktionabilität und Sicherheit sozialer Einrichtungen („a high probability that things will work out as well as can reasonable be expected [Aaron Antonovsky]).
Dieses nun meint: Das gesundheitswissenschaftliche Verständnis des Sinnzusammenhangs drückt in Form eines Lebensgefühls Gewissheit, Stetigkeit und Regelhaftigkeit ans. Es hat nach Aaron Antonovsky vier spezifische und wesentliche Dimensionen als notwendige Voraussetzungen, um (vor allem gegen destruktive Stressoren) innerhalb gegebener humaner Möglichkeiten und Grenzen letztlich gesundheitsförderlich und damit immunisierend wirken zu können. a) Verständlichkeit, Fachlichkeit, Ur-Vertrauen in Sinnhaftigkeiten von Situationen („comprehensibility“); b) Bewältigbarkeit oder Lösbarkeit von Situationen und/oder Problemen — bis hin zur Erkenntnis, auch mit ungelösten Problemen leben zu müssen und dies/e auszuhalten („manageability“); c) Sinnhaftigkeit als motivationales Moment handelnder Subjekte, also wohl auch, dass es eine sinnvolle (Sozial-) Ordnung gibt, dass alles Sinn macht („meaningfulness“); und schliesslich d) das definitive Wissen um unsere Grenzen: Als Gattungswesen, aber besonders als je innerhalb gegebener Möglichkeiten ,handelnde' Individuen. Dies meint auch subjektive Grenzsetzungen in dem Sinn: Eben nicht zu versuchen, diese Grenzen zu überschreiten und sich mehr oder weniger bewusst innerhalb der erkannten oder selbst gesetzten Grenzen aktiv zu bewegen (,boundaries“).
Damit geht es als entscheidende Ressource für Gesundheit auch nicht mehr um diese oder jene Einzelheit — etwa im sozialpsychologischen Feld: bewusste Missachtung negativistischer Einflüsse („selective ignorance“) —, sondern um eine Grundfrage unserer menschlichen Existenz (theoretisch) und unserer Lebensweise (empirisch). Klaus Hurrelmann hat diesen zentralen Aspekt erkannt, wenn er betont: „Es geht um ein positives Selbstbild der Handlungsfähigkeit, der Bewältigung von externen und internen Lebensbedingungen, der Gewissheit der Selbststeuerungsfähigkeit und der Gestaltbarkeit der Lebensbedingungen definiert mit dem Bestreben, den Lebensbedingungen einen subjektiven Sinn zu geben und sie mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen in Einklang bringen zu können.“[24]
Im Sinne von Geschichten hinter Geschichte hat für mich Aaron Antonovskys salutogenetischer Ansatz, dessen Herausbildung und Grundmodell ich skizzierte, zwei weitere Aspekte: Erstens scheint mir, über die beschriebene inhaltliche Seite hinaus, doch richtungsweisend im Sinne sozialwissenschaftliche Selbstbewusstheit der Januskopf gegenwärtiger Soziologien - einmal Funktions- bzw. Wirksamkeitssoziologie für empirische Evolutionsstudien, zum anderen Deutungs- und Sinnanalysen für gehaltvolle Bedeutungsuntersuchungen - zur Kenntlichkeit gebracht. Und mehr noch: Aaron Antonovskys pluraler Zugriff impliziert auch die meines Erachtens nötige und mögliche Vermittlung beider sozialwissenschaftlichen, der objekt- und der subjekt-bezogenen, Hauptrichtungen.
Und zweitens: Warum soll denn Aaron Antonovsky nicht, gerade weil der Autor als das medizinische Krankheitsmodell überwindender Sozial- und Kulturforscher humanwissenschaftlich einen meines Erachtens zentralen Aspekt des Geheimnisses von Gesundheit aufgeklärt hat, warum soll dieser Grenzgänger („marginal man“) zwischen zwei Doppelwelten denn nicht einen Nobelpreis erhalten? Und geschähe dies, wie üblich zu Lebzeiten, für seinen alternativmedizinischen, nämlich salutogenetischen Ansatz - dann wäre dem A recht was dem B billig war: Denn auch ein anderer kundiger Vertreter der ,New Chicago School' (Saul Bellow) erhielt den schwedischen Akademiepreis nicht für seine fachsoziologischen Studien, sondern (1976) als literarischer Autor. Und weil es immer noch keinen Nobelpreis für Sozialwissenschaften gibt — dürfte meines Erachtens wenig dagegen einzuwenden sein, wenn der Entdecker des Konzepts vorn Sinnzusammenhang für seinen Beitrag zur methodischen Profilierung von Gesundheitswissenschaften in der Sparte: Medizin den Nobelpreis zugesprochen erhielte ...
3. Das Modell des produktiv realitätverarbeitenden Subjekts
Anfang der 1980er Jahre gab es in der (damals noch alten) Bundesrepublik Deutschland sei's aus erfahrungsgesättigter familientherapeutischer Supervision, sei's aus der Sozialisationsforschung oder sei's aus der akademischen Lehre kommend verschiedene ähnlich gelagerte Versuche, individuelles und soziales Handeln von Menschen / Gruppen neu und reflexiv zu denken und auch handlungstheoretisch zu fundieren. Während im akademischen Lehrbetrieb aus eher katholisch-institutioneller Sicht Leo Montada auf Handlungsgrenzen aufmerksam machte]25], versuchte aus gleichsam 'linker' Position Klaus Holzkamp eine neokritische Begründung der Psychologie im allgemeinen und eine Vermittlung von Subjekt- und Objektwelt im besonderen: „,Menschliche' Handlungen“ — so Holzkamp grundlegend — "und Befindlichkeiten sind weder bloss unmittelbar-äusserlich ,bedingt' noch sind sie Resultat bloss ,subjektiver' Bedeutungsstiftungen oder ähnlich, sondern sie sind in den Lebensbedingungen ,begründet'.“[26]Und auch Klaus Horn versuchte, sich über bestimmte Formen sozialen Handelns, nämlich Handlungssperren, Blockaden, Unterlassungen, kurz: subjektiver Widerständigkeiten, im allgemeinen Handlungskonzept zu nähern und erinnerte zu Recht an die besondere Subjektqualität menschlichen sozialen Handelns, Intentionalitat und Sinnhaftigkeit: „In vielen Kontexten“' — betonte Horn — „ist der Begriff Verhalten üblich geworden (...). Verhalten ist nur die Aktivität oder Reaktion eines Organismus und seiner Herkunft nach ein objektivistischer Begriff. Wir ziehen den Begriff Handeln (...) vor, insofern er das Spezifikum menschlicher Aktivität hervorruft, dass nämlich absichtsvoll und sinnhaft gehandelt wird. Insofern solches Handeln sozial organisiert. ist, sprechen wir von sozialem Handeln.“[27]
Einen Vermittlungsschritt weiter ging zeitlich parallel eine eher gruppentherapeutisch ausgerichtete Münchner Forschungsgruppe um Wolfgang Buchholz/Heiner Keupp/Dodo Rerrich/Florian Straus et al. Auch hier wurde schon mit dem Konzept der subjektiven Verwundbarkeit („vulnerabi1ity“) im Sinne einer analytischen Sozialpsychologie oder auch klinischen Soziologie gearbeitet.[28] Aber mehr noch: Gerade weil sich die Forscher darüber klar waren, dass soziale Konformität. und Normanpassung gleichsam ,erzwungen' und durchgesetzt werden kann (und wird), konnten sie, ausgehend vom Konzept der familiären Doppelstruktur, eine eigenständige sozialpsychologische Perspektive entwickeln, nämlich das „Konzept der subjektiven Sozialstruktur" als (wie auch immer im einzelnen ausgeprägte) „angeeignete Form gesellschaftlicher Strukturprinzipien“; oder genauer: „Die subjektive Sozialstruktur kann als Bindeglied zwischen objektiven gesellschaftlichen Strukturmerkmalen und den tatsächlichen Handlungen des Individuums aufgefasst werden.“[29]
Dies halte ich für weiterführend. Und der eigene Ansatz versucht tatsächlich, das alte sozialphilosophisch-psychologische Grundproblem mittels einer dritten Ebene zwischen Individuum und Gesellschaft, eben ,subjektive Sozialstruktur', produktiv aufzulösen.[30]
Dies nun ist auch Klaus Hurrelmanns besonderes Anliegen als forschender akademischer (Sozial-) Pädagoge. Zunächst hatte der Autor - inzwischen Dekan der neuen Bielefelder Fakultät für Gesundheitswissenschaften und prominent gewordener Kindheits- und Jugendforscher der nordrhein-westfälischen Landesregierung - im Gefolge der bundesdeutschen Studentenbewegung kulturalistisch die immer schon gegebene Vergesellschaftung auch der im besonderen menschlichen Individualität und Persönlichkeit — freilich ohne etwa auf den Ansatz zweier ,Chicago'-Soziologen (Hans Gerth/Charles Wright Mills) über Charakter und Sozialstruktur zurückzugreifen — betont und akzentuiert, „dass sich die menschliche Persönlichkeit in keiner ihrer Dimensionen gesellschaftsfrei herausbildet, sondern stets in einer konkreten Lebenswelt, die gesellschaftlich-historisch vermittelt ist.“[31]
Später hat Hurrelmann dann den eigenen Ausgangspunkt erweitert. Und ein holistisches Handlungsmodell - etwa parallel zu den in diesem Abschnitt schon vorgestellten Autoren/Forschergruppen - skizziert, das jede Subjektivität ("empistemologisches Subjektmodell“) ins Zentrum stellt und so ein „Modell der dialektischen Beziehungen zwischen Subjekt und gesellschaftlich vermittelter Realität, eines interdependenten Zusammenhangs von individueller und gesellschaftlicher Veränderung und Entwicklung“ bezielt. Genauer: Hurrelmann selbst versteht sein Konzept als plurales „Model1, das das menschliche Subjekt in einen sozialen und ökologischen Kontext stellt, der subjektiv aufgenommen und verarbeitet wird, der in diesem Sinn also auf das Subjekt einwirkt, aber zugleich immer auch durch das Individuum beeinflusst, verändert und gestaltet wird.“[32]
Diese modellhafte Vorstellung vom ,produktiv realitätverarbeitenden Subjekt' eignet sich besonders für differenzierte, objektive Sozialwelten mit subjektiven Bedeutungsstrukturen kontrastierende Lehenswelt-, Lebens(ver)laufs- und Lebensspannen-Analysen (auch unter multimethodischer Perspektive). Aber mehr noch. Es bezielt auch vom Menschenbild her ein letztlich innere und äussere Realität produktiv verarbeitendes Subjekt — damit, so Hurrelmann weiter, das humane Gattungswesen als individuell „produktiven Realitätsverarbeiter.“[33]
Zentral wird dann - auch wissenschaftspublizistisch synchron zu Ulrich Becks soziologischer Zeitdiagnose unserer reflexiven Moderne mit ihren Handlungsanforderungen an aktive und neu vergesellschaftete Persönlichkeiten[34] - im Sinne einer avancierten Handlungstheorie die mit dem Schlagwort: Handlungskompetenz einhergehende je individuelle Fähigkeit, in konkreten Lagen/Situationen das gegebener „Passung“ entsprechende koordinativ-kooperative, für Person und Umwelt bedeutsame Agieren.“[35] Denn gerade angesichts struktureller Gefährdungen im gegenwärtigen Umbruchsprozess[36] steht ja auf menschliche Identität gerichtetes Handeln nie immer schon a priori fest, sondern [ist] ein Zustand des Selbsterlebens, der ständigen neuen Interpretations- und Aushandlungsprozessen mit der äusseren und der eigenen inneren Natur unterliegt.“[37]
Wichtig an Klaus Hurrelmanns dialektischem Handlungskonzept scheint mir's letztlich jeder bürgerlichen Aufklarung verpflichtete Festhalten an der humanen Gattungsmöglichkeit, nämlich: grundsätzlich produktiv handeln zu können und dabei sich selbst und die Lebensumstände (Umwelt) verändern zu können. Insofern scheint hier im erkenntnisleitenden subjektwissenschaftlichen Ansatz immer schon ein zunehmend wichtiger werdendes Moment, nicht nur im gesundheitswissenschaft-lichen Sinn, auf: ich meine die Seite von ,subjektiver Produktivkraft', die in strategischer menschlicher Handlungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft strukturell angelegt ist (und die auch national- und sozialökonomisch als ,weicher' Allokations- und/oder Standortfaktor im Sinne ,substainable economy' immer bedeutsamer werden dürfte).
Am Beispiel und aus nicht nur eigner dozentischer Erfahrung im Feld von erwünschtem oder verkündetem ,sicherem' Verhalten in Unternehmungen gesprochen und auf den Bereich von gesundheitlichen Handlungen oder auch sexuellen Praktiken übertragbar und letztlich damit auch aufs Gesamtfeld von ,Prävention' als Handlungsmodell anzuwenden: Denn tatsächlich hat alle „personale Intervention“ — also etwa Anregungen zu arbeitssicherem Verhalten im Sinne einer Pädagogik von Unfallverhütung, zu ,gesunder' Ernährung einschliesslich Verzicht auf gefährdende Genussmittel oder auch zu ,safe-sex'-Vorbeugehandeln — immer dort ihre definitiven Grenzen, „wo die Verantwortlichkeiten der Personen, die sie meint, enden, wo stabile Strukturen Handlungsalternativen nicht zulassen.“[38]
So gesehen hält Klaus Hurrelmann mit aller Aufklärung an der im Gattungswesen ,Mensch' als homo rationalis strukturell angelegten Möglichkeit produktiver Realitätsaneignung und progressiver Wirklichkeitsveränderung fest. Und besteht auf humanen Handlungsalternativen ... auch wenn ich meine, dass es wegen der auto- und gattungsdestruktiven Wirksamkeit Alternativen gibt, vor die kein Mensch jemals gestellt werden sollte ...
4. Ein Perspektivenwechsel und seine Konsequenzen
„Spannend wie Krimis“ — hiess es kürzlich in einer Theaterkritik der Recklinghauser Festspiele — „sind die Forschungsberichte, die der englische Neurologe Oliver Sacks herausgibt; kein Wunder, dass die Kulturindustrie sie für sich entdeckt hat, zumal der schwergewichtige Professor [...] ein äusserst eloquenter Medientalker ist. Jetzt hat Star-Regisseur Peter Brook die Sammlung, „Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“ fürs Theater bearbeitet. Episoden aus dem Leben psychisch Gestörter, Sequenzen zwischen Arzt und Patient wurden zu einem bejubelten Höhepunkt des Festivals — faszinierende Studien, die nicht nur Krankengeschichten anreissen, sondern auch jene zweifelhafte Schwelle zwischen ,Normalität' und Wahnsinn in Frage stellen.“[39]Grenzen zwischen dem, was als Normalität gilt und was als verrückt definiert ist, stellen die — ich sehe folgend von den auch deutsch publizierten Fachbüchern „Zeit des Erwachens“ (1991) und ,Migräne“ (1994, beide bei Rowohlt erschienen) ab — literarpublizistischen Mignetten des britisch-US-amerikanischen Neurologen und Medizinsystem-Kritikers Oliver Sacks auch in Frage. Das freilich unternimmt hierzulande höchstbedeutsam jemand wie der leitende (anthropologisch arbeitende) Psychiater Wolfgang Blarikenburg auch[40] — ohne jemals Massenmedienresonanz zu erfahren oder gar zum Buch- und Theater-Bestseller zu avancieren.
Hierin dem Ausgangspunkt besonders der anglo-amerikanischen sozialwissenschaftlichen Ethnomethodologie verbunden, produziert der Autor Oliver Sacks in seinen alltäglichen Lebens(krisen)geschichten und Fallbeispielen zunächst Paradoxien — also auch erfahrungsgesättigte, auf dem Wechsel gewohnter Sichtweisen und (scheinbar) gesicherter Erfahrungen beruhende Umkehrungen der Perspektive: Das beginnt mit dem autobiographischen Bericht über die Folgen eines Bergsteigerunfalls[41], in dessen Folge der verunglückte Arzt selbst zum Patienten wird und im Wissen, Arzt zu sein, was nur zunächst er allein weiss, als Patient behandelt wird[42], geht über zu Fallgeschichten über wirkliche oder scheinbare Verrücktheiten aus der psychotherapeutischen Alltagserfahrung[43] — und endet mit einer bewusst ins eigene Erfahrungsinnere angelegten Reise in die soziale Erfahrungswelt von Taubstummen[44], so, als ob es nicht paradox wäre, mit den eigenen Augen hören und mit der eigenen Stimme nicht sprechen zu können; dies drückt auch der Originaltitel ("Seeing Voices“, also Stimmen sehen) besser aus als der deutschsprachige Stabreim „stumme stimmen“[45] Was in der unfreiwilligen Erfahrung der Bergverunfallung im nordnorwegischen Gebiet unfreiwillig begann — endete damit zunächst mit der bewusst-freiwilligen Erkundung einer zunächst fremden Sozialwelt der Gehörlosen und ihrer (relativ selbständigen Gebärden-) Sprache.
Allein freilich mit dem Etikett: Paradoxien ist die empirisch erweisliche (Medien-) Wirksamkeit des Doktor Sacks meines Erachtens eben nicht zu erklären: Ich denke eher, dass dies zumindest zwei weitergehende Wirksamkeitsketten konnten: Einmal die bewusste Vernutzung von zentralen Elementen, die schon Sigmund Freud (1905) als Wirkungstechniken von Wort- und Bild-Witzen erkannte[46], hier vor allem: Sinnverschiebung und Perspektivenwechsel, bewusstes Wörtlichnehmen von personalen Lagen und nicht zuletzt soziale Situationsverfremdung."[47]
Und zum anderen kann der Schriftsteller Oliver Sacks uns mit Hilfe seiner (fach-)ärztlichen, alltäglich-patientischen und grenzgängerischen Erfahrungen im Sinne eines "marginal man“ letztlich und ohne uns denunziatorisch gleichsam vorzuführen in unserer mehr oder weniger normalen bürgerlichen Existenz an die Doppelbödigkeit oder Janusköpfigkeit unserer realen Lebensweisen und damit auch an im menschlichen Sein als solchem angelegte Gattungsbesonder-heiten erinnern: Indem Oliver Sacks nämlich wie im anderen Genre vor ihm schon der sizilianische Krimi-Autor Leonardo Sciascia in seinen Opfer-Täter-Rollen ,verkehrenden' Geschichten[48] — dort wird irgendwann der Polizeiapparat ,kriminell' — jenen bewussten Perspektivenwechsel vornimmt und gezielt Paradoxien produziert - erinnert er, wie schon grundlegend Sigmund Freud und vor Sacks zuletzt als Wissenschaftler Gregory Bateson[49] an die in unserer conditio humana immer schon strukturell angelegte „latente Potentialität“ (Gregory Bateson)[50} und die Benachbarung von Produktivität und Destruktivität, von Witz und Schizophrenie, von Kunst und Kriminalität und damit letztlich auch an die Form unserer Sozietät und unsere Lebensweise, von denen abhängt, welche der Möglichkeiten im Alltagsleben empirisch praktisch werden kann und wird.
5. Gesundheitswissenschaften als empirische Sozialwissenschaft: Zum Handbuch "Gesundheitswissenschaften" – ein Vorschlag zur Güte
Weit verbreitet ist die Annahme, im Handlungsfeld Wissenschaft ginge es prinzipiell anders zu als im alltäglichen Leben. Dass es gerade dann, wenn in wissenschaftlichen Arbeitsfeldern neue Ideen und innovative Konzepte durchgesetzt werden sollen, zunächst abläuft wie in jedem gewöhnlichen deutschen Kleingärtnerverein — dies zeigt das gewichtige Handbuch für Lehre, Forschung und Praxis zu „Gesundheitswissenschaften“ so exemplarisch wie anschaulich.[51] Mit anderen Worten: Mit Blick auf die hier entfaltete Perspektive, dass nämlich Aaron Antonovsky's salutogenetisches Modell erstens ein Kontinuitätsmodell von Krankheit und Gesundheit bezielt, dass es zweitens endlich als Leitfrage ausspricht, warum bei vergleichbaren Gesundheitsrisiken bestimmte Menschen / Gruppen eben nicht ,krank' werden, sich also durch subjektive Situationsbewältigung gleichsam ,resistent' entwickeln (können), und dass es drittens im breiten Spektrum Gesundheit / Krankheit entsprechend der sozialen Entwicklung speziell auf Krankheits-, Beeinträchtigungs- und Behinderungsformen zielt, die mit Lebensphasen und kritischen Lebensereignissen assoziert sind — diese zentralen Grundüberlegungen scheinen, dem generellen gesundheitswissenschaftlichen Anspruch zum Trotz, im Handbuch nämlich letztlich doch nur wieder in sieben von insgesamt 21 Beiträgen auf.
Zugespitzt formuliert: Es scheint so, als hängt sich nun allerlei und diese und jener an den neuen Paradigmen-Zug, freilich nur mitläuferisch im Sinne des ,bangwaggon-impuls' und äusserlich. In Wirklichkeit wird das, was man/frau eh immer schon gemacht hat („business as usual“) unternommen. Und deshalb akzeptiere ich auch nicht — beide Beispiele als pars pro toto —, wenn mir unter dem Rubrum „Medizinische Grundlagen der Gesundheitswissenschaften“ (Handbuch S. 26-45) eben doch nur wieder etwa im Abschnitt Atemwegserkrankungen ganz traditionell Lehrbuchwissen („Beim Asthma kommt es anfallsweise zu Atemnot durch eine starke Verengung der Atemwege“, 30) als „Gesundheitswissenschaft“ verkauft wird.
Ähnlich traditionell, oberflächlich und einem medizinisch-physiologischen Wirkungsmodell verpflichtet der Beitrag „Arbeitswelt und Gesundheit“ (Handbuch, S. 277-294). Die Autorin, Universitätsprofessorin und Direktorin der Abteilung Umweltphysiologie und Arbeitsmedizin an der Universität Dortmund, zeigt hier das im Arbeitsschutz immer noch dominante reduktionistische Modell mit dem auch ihren Ausführungen unterliegenden Menschenbild und damit, dass sie die produktiven Leitfragen und wissenschaftlichen Herausforderungen von Salutogenetik / Gesundheitswissenschaften als theoriegeleiteter empirischer Sozialwissenschaft nicht aufnehmen konnte.
Im verbleibenden Drittel der Handbuch-Aufsätze, deren Autoren sich tatsächlich der neuen Sichtweise verpflichtet fühlen und die auch versuchen, sie weiterzuentwickeln - etwa die Herausgeber („Gesundheitswissenschaften als interdisziplinäre Herausforderung“, S. 4-25, dort auch eine Kontrastierung Krankheits- versus Gesundheitswissenschaften) oder Irmgard Vogt über „Psychologische Grundlagen der Gesundheitswissenschaften“ (S. 46-62, mit Hinweisen auf differente Bewältigungsstrategien) oder auch die Handbuchartikel zu „Epidemiologischen Methoden“ und „Statistischen Methoden“ der Gesundheitswissenschaften wie schliesslich die Beiträge zu „Epidemiologie von Gesundheit und Krankheit“ und zu "Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung“ (S. 91-134; S. 137-154; S. 176-203) - sticht meines Erachtens der Lehrbuchtext zu „Soziologische Grundlagen der Gesundheitswissenschaften“ so hervor, dass Bernhard Baduras Ansatz abschliessend wenigstens in den Grundzügen vorgestellt werden sollte (Handbuch, S. 63-87). Hier nimmt der Autor auch seinen vor Jahren skizzierton Zugriff zum emotionalen Defizit oder zur unangemessenen Gefühlssteuerung bei bisherigen Formen von Krankheitsbewältigungshandeln („coping“) wieder auf[52] und systematisiert ihn im Zusammenhang mit Überlegungen aus der Stressforschung zu einem handlungsspezifischen Gesundheitsbegriff (S. 77): „Gesundheit ist aus der Sicht der Stressforschung (...) eine Kompetenz oder Befähigung zur Problemlösung und Gefühlsregulierung, durch die ein positives Selbstbild, ein positives seelisches und somatisches Befinden erhalten oder wiederhergestellt wird.“[53]
Gerade wenn diese subjektive Möglichkeit von (Wieder-) Herstellung sinnhafter Lebenszusammenhänge nicht gegeben ist oder erscheint — können „zahlreiche Formen sogenannten ,selbstdestruktiven' Handelns als Ausdruck mangelhafter Möglichkeiten zur zwischenmenschlichen Gefühlsregulierung“ praktisch greifen, etwa Sozialisation und/oder beständige Über- oder Unterforderung (Handbuch, S. 74). Wie überhaupt, so Badura, immer dann Stressphänomene als Nichtballancen auftreten, wenn's Konflikte gibt „zwischen Lebensbedingungen, Zwängen und Erwartungen auf der einen und individuell gegebenen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Ressourcen auf der anderen Seite, und wenn dies (...) vom einzelnen als sein Wohlbefinden bedrohend oder beeinträchtigend erfahren wird“ (Handbuch, S. 75/76).
Und folglich plädiert Badura als Gesundheitswissenschaftler, der diesen Namen verdient, für „Erforschung potentiell gesundheitsförderlicher Einflussfaktoren wie soziale Integration und soziale Unterstützung, Handlungsspielraum, Kohärenzempfinden, positives Selbstwertgefühl“ (Handbuch, S. 76). Denn die auch gesundheitspädagogisch relevante Option des Autors liegt darin, "schädigende Umwelteinflüsse zu verringern und Gesundheitspotentiale zu erschliessen und zu fördern - unabhängig vom Verhalten der einzelnen“ (Handbuch, S. 78).
Zum Schluss: Noch einmal über Grenzen ...
Wenn Gesundheit, zumal im Sinne der vorangestellten WHO-Bestimmung (1946) viel, aber nie alles sein kann; dann wird auch alle Gesundheitswissenschaft als Wissenschaft von Gesundheit ihre Grenzen erfahren als empirische Sozialwissenschaft.Über diese Grenzen hinaus freilich gibt es weitere, in der conditio humana menschlicher Gattungsexistenz begründete. Erstens muss das lange Leben nicht unbedingt das beanspruchte gute Leben sein, oder plakativ: Besser'n erfülltes (kurzes) Leben als mit Achtzig noch dem Glück hinterherjagen. Und zweitens findet in meinem Verständnis jedes gute Leben dort seine Grenzen, wo es auf Kosten anderer gelebt wird. Und das gilt auch für jede gesellschaftliche Verallgemeinerung von Gesundheit — zum Beispiel als „gesunde Gesellschaft“. Und vermutlich wird wohl auch das, was im westlichen Zivilisationsmodell strukturell als nicht sinn- und balancefähig, damit auch emotional nicht eingrenzbar und handelnd regelbar, angelegt ist, etwas sein, was sich, und nicht nur zu gesundheitlich-salutogenetischen Bemühungen, ,quer' und sperrig verhält.
Damit stellt sich sicherlich auch aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht die Frage nach den Grenzen unserer gegenwärtigen Vergemeinschaftungs-, Vergesellschaftungs- und Lebensweise und zugleich die nach neuen Ufern anderer, alternativer Formen und Sozialmodelle. Hierbei freilich dürfte gelten, ich zitiere aus der deutschsprachigen Zusammenfassung des ,Utopian Paradigm':
„Jedes neue Zivilisationsmodell meint aber zugleich auch eine andere soziale Ordnung, die mit dem empirisch immer bedeutsamer werdenden ,emotionalen Überschuss (mental surplus), den es in jeder Gesellschaft gibt, strukturell zusammenhängt. Damit dürfte sich zukünftig - und zunehmend - auch wieder ein altes menschliches Grundproblem neu stellen: Wie eine gerechte(re) Sozialordnung möglich ist."[54]