Yassamin-Sophia Boussaoud: Chaos. Von Gefühlen und anderen Menschlichkeiten Alltägliches Chaos der Diskriminierung
Sachliteratur
Eigentlich hatte ich das Buch für jemand anderes bestellt, las Chaos. Von Gefühlen und anderen Menschlichkeiten (2024) dann aber zügig an zwei Wochenends-Vormittagen durch.
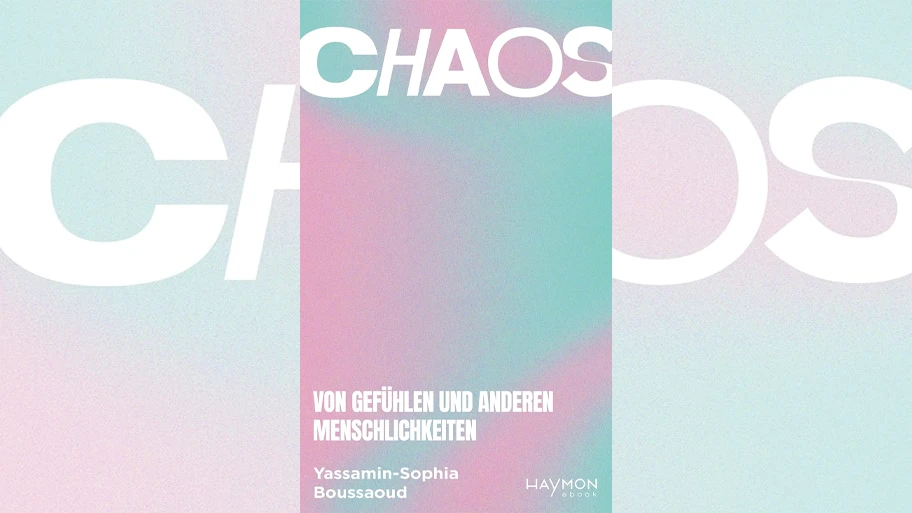
Mehr Artikel
Buchcover.
0
0
Als Mutter, queere, dick_fette, nicht-binäre Person, deren Vater aus Tunesien stammt, hat sie im Kontrast zur äusserst konservativ geprägten Umgebung ihrer Jugend, aber auch bis heute, täglich zu spüren bekommen, was es bedeutet, in einer staatlich-kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft nicht der Norm zu entsprechen.
Der Hang zum Subjektivismus mag auch ein gewisser Trend unserer Zeit sein. Die Beschreibung des eigenen Empfindens, stellte und stellt für Menschen ohne relevantes Privateigentum einen Weg dar, als Bürger*innen anerkannt zu werden. Umso mehr gilt es diesen Erfahrungen und damit verbundenen Sichtweisen jedoch Raum in einer weiss, männlich, hetero, neuronormativ dominierten Gesellschaftsform zu geben. Diese Sichtbarmachung ist ein Aufbrechen der stahlharten Dominanzstrukturen auch unserer Zeit – und verleiht zugleich schlichtweg jenen Gerechtigkeit, die sonst kaum Gehör finden. In diesem Zusammenhang beindruckt der Mut von Yassamin-Sophia Boussaoud, ihre Gedanken in die Öffentlichkeit zu tragen (insbesondere auch bei Instagram) und damit Menschen zu inspirieren, die ebenfalls angekotzt von ihrer Normierung, Disziplinierung, Missachtung und Ausbeutung sind. Die billige Behauptung, hierbei handele es sich um blosse „Identitätspolitik“, die der sozialen Rolle diskriminierter Personen vermeintlich per se tiefere Einsichten zugesteht, ist dabei lächerlich. Boussaoud versteht und thematisiert nämlich durchaus, dass Entwürdigung mit der staatlichen und kapitalistischen Herrschaftsordnung zusammenhängt. Hierbei handelt es sich jedoch um komplexe und ineinander verschränkte Verhältnisse: Die hypothetische Aufhebung von Staat und Kapitalismus würde nicht einfach Auflösung von Rassismus, Sexismus, Hetero- und Neuronormalität führen.
Für eine erklärtermassen subjektivistischen Schrift hat der Text wiederum viel Tiefgang und kompliziertere theoretische Voraussetzungen. Die Sprache und Gedankenwelt der poststrukturalistisch geprägten Sozialwissenschaften mag auf einige abschreckend wirken und ist voraussetzungsvoll. Dies ändert nichts daran, dass die für die Autor*in-Person und jene, die sich von ihren Inhalten und Sichtweisen angesprochen fühlen, emanzipierendes Potenzial hat. Der Versuch Worte für komplexe Erfahrungen und Empfindungen zu finden und diese im Kontext einer bestimmten Gesellschaftsform zu begreifen, ist die eine Vorbedingung für Ermächtigung. Insofern kann auch diskutiert werden, inwiefern es sich bei Chaos. Von Gefühlen und anderen Menschlichkeiten auch um ein anarch@-individualistisches Buch handelt.
Es folgen einige Auszüge aus dem Buch, die ich abgetippt habe:
„Über die Jahre habe ich gelernt, dass meine Gefühle valide sind – die daraus folgenden Handlungen jedoch nicht immer. Ich habe gelernt, dass der Schlüssel nicht darin liegt, das Chaos in mir aufzulösen, sondern es zu verstehen. Mich verstehen zu lernen. Und dass Selbstliebe keine Bedingung ist.
Ich würde heute nicht mehr behaupten, dass ich mich selbst liebe. Ehrlich gesagt weiss ich nicht, ob dies jemals so sein wird. Aber ich bin mir heutzutage ein*e Freund*in. Was bedeutet, dass ich manchmal sanft zu mir bin und manchmal hart zu mir sein muss. […] Denn ich bin nur ein einziger, letztendlich unbedeutender Mensch in diesem unendlich grossen Universum. Und ich glaube, dass es mehr als genug Menschen gibt, die auf sich schauen. Ich möchte mich bewusst dazu entscheiden, auf andere zu schauen. Zusammenhalt, Care-Arbeit und der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen den höchsten Stellenwert in meinem Leben zu geben. Ich möchte eine*r von Vielen sein. Mich selbst nicht zu wichtig nehmen und zugestehen. Das ist nicht einfach und es ist nichts, was man* einmal lernt und dann kann.
Ich glaube, das ist meine grösste Erkenntnis, dass es kein Ende, kein Ankommen, keinen Zustand gibt, in dem wir als Menschen fertig sind, Dass unsere Gefühle keinen Anfang und kein Ende haben. Dass wir nicht allgemeingültig lernen können, wie wir zu welchem Zeitpunkt mit unseren Gefühlen umgehen. Dass Gefühle nicht linear sind, keine Einbahnstrasse“ (S. 16f.) „Erschöpft davon, zu sein. So erschöpft davon, dass ich jedoch nie einfach sein kann. Dass in mir ein Sturm, die Unruhe tobt. Ich bin erschöpft vom Glauben. Vom Glauben daran, dass alles einen Sinn hat oder haben muss. Diese Welt ist grausam. Ich bin erschöpft davon, Menschen mit mehr Geduld und Empathie zu begegnen, als sie mir entgegenbringen. Immer zu lächeln, härter zu arbeiten. Hilfe anzubieten. Damit mich niemand hasst. Und dennoch werde ich gehasst.
Ich bin erschöpft davon, hoffnungsvoll zu sein. Erschöpft vom Glauben an die Menschlichkeit. An den Anstand. Erschöpft vom sturen Festhalten an Werten, die so wenige teilen. Unglaublich erschöpft vom Widerstand. Und ehrlich gesagt bin ich am allermeisten erschöpft davon, so zu tun, als könnte ich das alles aushalten. Als würde es mir nichts ausmachen. Als könnte ich wegstecken, wenn Menschen nicht empathisch mit mir umgehen. Als könnte ich täglichen Widerstand und Ablehnung und ständige Existenzängste und dieses viele damit Alleinsein einfach so aushalten. Und das ist eines der grausamsten Dinge, die uns angetan werden. Das Absprechen unserer Sanftheit. Wir, die so laut fühlen. So sehr fühlen, dass es uns fast zerreisst. So sehr fühlen, bis wir uns nicht mehr fühlen können. Weil wir funktionieren müssen, stark tun und zu häufig auch stark sein müssen.
Die weisse Mehrheitsgesellschaft sieht Schwarze und Braune Menschen als besonders stark und robust an. Nicht im positiven Sinne, Es ist Grundlage, uns unseren Schmerz, unsere Schwierigkeiten, unsere Sanftheit abzusprechen. Grundlage für Entmenschlichung. Denn wer so stark ist, braucht keine Hilfe. Wer so stark ist, kann Gewalt ‚aushalten'“ (S. 34f).
„Ich musste über Jahre lernen, mir meinen Wert nicht weiter abzusprechen. Und manchmal frage ich mich, wie mein Leben wohl aussehen würde, hätte man* mir beigebracht, dass ich wertvoll bin. Ich frage mich, ob bestimmte Diskriminierungsformen dann ganz genauso auf mich gewirkt hätten. Ich frage mich, wie meine Freund*innenschaften, meine Beziehungen wohl aussehen würden. Wie wäre die Welt“ (S. 50)?
„Die Wahrheit ist doch eigentlich die, dass diese Welt, so wie sie heute ist, wenig Hoffnung macht. Und doch gibt es so viele Menschen, die daran glauben. Dass es besser werden kann. Ich gehöre manchmal zu ihnen.
Auch wenn ich mich meist so machtlos fühle. Auch wenn mir die aktuelle politische Lage in Deutschland und Österreich, in ganz Europa Angst macht. Ich könnte und würde aktuell nicht einfach gehen, mit welchen Ressourcen auch. Ich bin das Kind meines Vaters. Ich habe es durch Armut und Perspektivlosigkeit, als alleinerziehendes Elternteil, durch Wohnungslosigkeit und Krankheit geschafft und ja, manchmal habe ich keine Kraft mehr. Manchmal muss ich weinen und kann kaum noch aufhören. Aber es ist die Hoffnung, die mich in diesen Momenten doch weitermachen lässt. […]
Vielleicht ist die Hoffnung so kraftvoll, weil sie erst dann so wichtig wird, wenn wir eigentlich schon fast am Ende sind.
Vielleicht ist sie so kraftvoll, weil sie auch aus der grössten Angst heraus, aus unbändiger Wut heraus entstehen kann,
Und vielleicht sind Hoffnung und Hoffnungslosigkeit näher beieinander, als wir uns eingestehen können“ (S. 76f.).
„Wenn uns unser Recht auf Wut abgesprochen wird, wird Diskriminierung geleugnet und so aufrechterhalten. Die Herabwürdigung unserer legitimen Wut ist ein extrem gewaltsamer, weisser, patriarchaler Schutzmechanismus. Das habe ich selbst lange nicht verstanden. Ich habe in meinem Aktivismus oft sehr sanft agiert, rein auf Aufklärung gesetzt und dieses Narrativ reproduziert.
Was ich nämlich nicht verstand, war, dass jede Revolution zunächst einmal mit unbändiger Wut begann. So beginnen muss. Nur so beginnen kann. Wut kann ein Geschenk sein. Wut kann heilsam sein. Ich jedoch habe mein ganzes Leben lang gelernt, genau diese Wut nicht zuzulassen. Ich wollte natürlich weder ‚zu wild' noch zu emotional oder gar irrational und hysterisch sein. Und so wurden aus meiner Wut viele Selbstzweifel.
Selbstzweifel, die nur langsam vergehen. Doch je mehr ich beginne zu verstehen, je weniger Täuschung möglich ist, desto wütender kann ich sein. Und mir meine Wut und darüber hinaus meinen Hass zugestehen, Ich schäme mich nicht mehr für diese Gefühle, sind sie doch die einzig gesunde Reaktion auf diesen absoluten Witz, den wir soziale Gesellschaft nennen“ (S. 114).
Yassamin-Sophia Boussaoud: Chaos. Von Gefühlen und anderen Menschlichkeiten. Haymon Verlag 2024. 188 Seiten, ca. 24.00 SFr. ASIN: B0CY2QBQ7F.


