Sebastian Venske: Gustav Landauer als jüdischer Intellektueller? Publikation: Landauer als jüdischer Intellektueller
Sachliteratur
Schon seit längerer Zeit beschäftigte mich selbst das Denken Gustav Landauers, aufgrund dessen spezifischer Herangehensweise, aus verschiedenen Gedankensträngen Synthesen zu bilden.
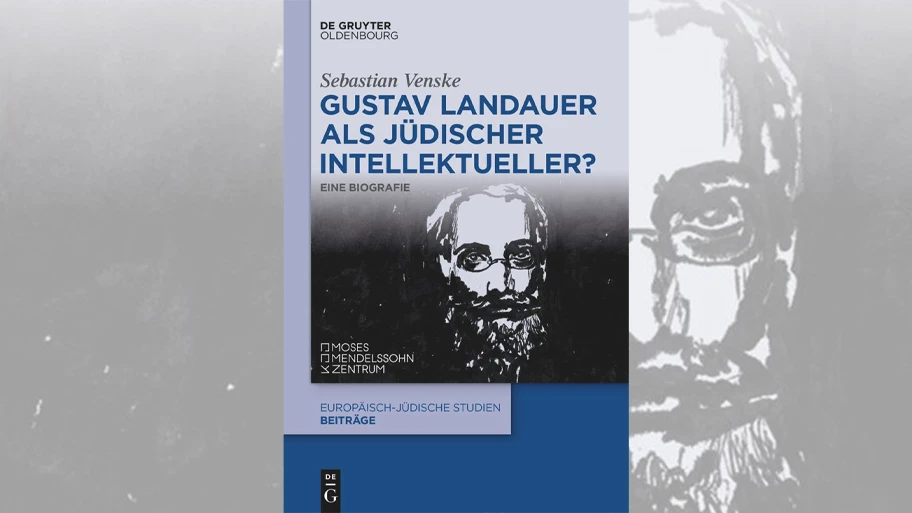
Mehr Artikel
Buchcover.
2
0
Meiner Ansicht nach gibt es Sinn, Landauer als Protagonisten einer Tendenz des Anarchismus zu verstehen, die als „kommunitärer Anarchismus“ oder „anarchistischer Kommunitarismus“ verstanden werden kann, wie John P. Clark es tut. Landauer ist als Person und in seinem spezifischen Denken so interessant, weil er in einer Gesellschaftsform agiert, die sich im grundlegenden Wandel befindet – und darin und darauf nach umfassenden Antworten sucht. Dabei faszinieren insbesondere Landauers eigene theoretischen Konzepte, wie das des verbindenden, sinnstiftenden „Geistes“, das Motiv des „Exodus“ oder sein Ansatzpunkt der Neugründung von „echten“ Gemeinschaften, die eine dezidiert präfigurative und gegenkulturelle Strategie darstellt.
Als Protagonist einer alternativen Moderne im anarchistischen Sinne ist Landauer auch deswegen interessant, weil in Anschluss an ihn auch Perspektiven auf gesellschaftlichen Wandel heute stark gemacht werden können, die entgegen der faschistischen Tendenz dieser Zeit, zu anderen Einsichten kommt, als es mit herkömmlichen sozialistischen Positionen möglich ist. In diese Zusammenhang beschäftigt sich Landauer auch insbesondere mit dem Thema der Entfremdung des modernen Menschen. – Obwohl ich mich nicht als Landauer-Apologet verstehe, finde ich nach wie vor viel Inspirierendes an ihm. Interessant ist allerdings vor allem er als Person als Ausdruck und Akteur in einem bestimmten gesellschaftlich-politischen Kontext. Der naheliegende Schnittpunkt zu meiner eigenen Arbeit findet sich beim Verständnis von anarchistischer (Anti-)Politik. Sebastian Venske veröffentlichte Anfang diesen Jahres bei DeGruyter seine Dissertation mit dem Titel „Gustav Landauer als jüdischer Intellektueller?“ Der Forscher nimmt dabei die intellektuelle Biografie als Methode, um der Frage nachzugehen, inwiefern Gustav Landauer ein jüdischer Intellektueller war. Daraus ergibt sich eine detaillierte Suche nach Landauers ambivalentes und in biografischen Phasen und Kontexten wechselndes Verhältnis zum Judentum insgesamt, als biografischer Hintergrund, kultureller Rahmen, in Bezugnahme und Abgrenzung zum Nationalismus und schliesslich auch zur Religion und einer Denkweise, aus der auch politisch-theoretische Begriffe entlehnt werden.
Venske rekonstruiert Landauers Entwicklung dabei in fünf Phasen und ergänzt dessen bekannte Texte durch Informationen anhand seines Briefwechsels. Das Buch ist flüssig geschrieben, klar strukturiert und gut nachvollziehbar. Insofern eignet es sich gut für alle Personen, die sich dem Thema von verschiedener Seite her annähern wollen. Es ist Open Access verfügbar unter: https://www.degruyterbrill.com. Es folgen einige Textpassagen zur Dokumentation, die ich aufschlussreich fand:
Auf einer theoretischen Ebene lässt sich festhalten, dass Identität ein Prozess zur Konstruktion von Selbstbildern ist. Diese Selbstbilder werden im Laufe des Lebens durch soziale Interaktion vermittelt, stabilisiert, aber auch revidiert. Identität ist also nicht unveränderlich, sondern abhängig vom sozialen Umfeld und potenziell fluide. Die im Laufe des Lebens erworbenen Einstellungen, Zugehörigkeitsgefühle, Selbstbilder, Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, kulturellen Praktiken und so weiter, bilden ein Reservoir an situativ aktivierbaren Aspekten einer Persönlichkeit. Somit bilden sich Identitäten nicht willkürlich, sondern in Relation zu Anderen und Identitäten sind auf die Resonanz und zumindest eine gewisse Anerkennung anderer angewiesen. – S. 14
In der Regel ging man in Landauers Zeit von stabilen, unveränderlichen Identitäten bzw. Wesenskernen aus. Diese Ansicht wurde durch die Aufklärung und Emanzipation zunehmend in Frage gestellt – sowohl im christlichen als auch im jüdischen Teil der Bevölkerung. Familienstrukturen, die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft veränderten sich im 19. Jahrhundert mit zunehmender Geschwindigkeit. Diese Veränderungen wirkten sich auf die Selbstwahrnehmung der Menschen aus und verunsicherten sie. Als Folge und im Rahmen des deutschen Nationsbildungsprozesses wurden einzelne Identitäten mit einem Absolutheitsanspruch versehen. So führte der deutsche Nationalismus dazu, dass Deutsche einem Jüdischen gegenübergestellt wurden. Jüdinnen:Juden waren zwar schon immer nichtjüdischen Symbolen und Ideen ausgesetzt, doch zu einer Krise des Selbstverständnisses führten erst einzelne totalitäre Identitätsansprüche, mit denen Jüdinnen:Juden konfrontiert wurden. So konnten sie entweder jüdisch oder christlich sein, jüdisch oder deutsch, Zionist:innen oder nationaldeutsche Jüdinnen:Juden. Eine der Reaktionen auf diese Entwicklung war die Entstehung der unterschiedlichen jüdischen Denominationen, die versuchten sich verschiedenen Identitätsforderungen anzupassen bzw. sich von ihnen abzugrenzen. Jüdische Identität wurde also erst zu einem Problem als sich die gesellschaftliche Vorstellung von Identitäten immer weiter einengte und Vielfalt und Ambiguität verloren ging. – S. 15
Landauer verteidigt „zwar den Klassenkampf, bezweifelte allerdings, dass dieser in Form von Streiks den Kapitalismus überwinden könne. Nur ein Streik, der dazu führe, dass sich die Menschen aus ihren Unterdrückungsverhältnissen lösen, könne eine Relevanz entwickeln. Dieser Einwand führte bei Landauer zu der Einsicht, dass sein politisches Wirken nicht auf die Zukunft gerichtet sein sollte, sondern auf das Handeln in der Gegenwart.98 Diesen Fokus auf das Individuum in Verbindung mit der Ablehnung von politischen Institutionen wie dem Parlament oder dem Staat brachte Landauer dazu seinen Anarchismus-Sozialismus ab 1897 als antipolitisch zu bezeichnen.99 Damit rückte Landauer die kulturelle Revolution des individuellen Bewusstseins in den Vordergrund seines politischen Denkens. Er vollzog damit selbst einen Wandel hin zu einem anderen Verständnis von Sozialismus, das sich den Vorstellungen von Gruppen wie den Friedrichshagenern annäherte und Landauer im Feld der politisch linken Denker:innen eine ganz eigene spezifische Position sicherte. – S. 48
Mit seinem Krisenempfinden war Gustav Landauer nicht allein. In der Zeit um 1900 war ein allgemeines Krisenempfinden in der Gesellschaft anzutreffen. Besonders die rasante Modernisierung, die sich in einer zunehmenden Urbanisierung, Säkularisierung und Technisierung ausdrückte, machte vielen Menschen zu schaffen. Die Welt veränderte sich so schnell, dass sich ein kollektives Empfinden von Umbruchszeit und Krise verbreitete. Dieses Gefühl wird in der Literatur gern als Fin de Siècle-Stimmung beschrieben. Für das Fin de Siècle wurde die Sprachskepsis ebenso als Motiv herausgearbeitet wie die in sich verwobenen, aber spannungsgeladenen Aspekte von Konservatismus und Progressivität oder Tradition und Modernität, die in der damaligen Zeit aufeinandertrafen. Für diese Widersprüchlichkeit innerhalb der Zeit kann auch das Denken Landauers herangezogen werden, der in seiner Vorstellung von Revolution ebenfalls konservative mit progressiven Elementen verband.24 Landauer war personell und intellektuell eingebunden in die zeittypischen Phänomene der wilhelminischen Gesellschaft und gleichzeitig ein Protagonist der Gegenkulturellen, also des gegen die bürgerlich anerkannten Formen des Normativen gerichteten Kulturlebens. Aus den Spannungen und Entwicklungen der Zeit heraus entstanden Unsicherheiten, die das Aufkommen neuer Bewältigungsstrategien wie die Lebensreformbewegung, die völkische Bewegung, ein Renaissancekult und viele weitere begünstigten. In diesem Kontext sich pluralisierender Identitätsangebote ist auch Landauers Wirken jener Zeit zu sehen, deutlich wurde, wie sehr er mit seiner Beschäftigung mit Skepsis und Mystik im Zentrum der damaligen intellektuellen Entwicklungen stand. – S. 56f.
Martin Buber bezeichnete mit Zwischenmenschlich eine Kraft, die einzelne Individuen verbindet.15 Diese Verbindung entstünde nicht ausschliesslich aus der direkten Beziehung dieser Individuen, vielmehr verweise die Verbindung zusätzlich auf etwas Drittes ausserhalb dieser Beziehung, auf das die Individuen ebenfalls bezogen seien. Bei Landauer fungierte dessen Idee von Geist als dieses Dritte. Der Geist entstehe zwischen den Menschen, sei Ausdruck ihrer Beziehungen zueinander, weise aber zugleich über sie hinaus. Man könnte dies als transzendente Kraft interpretieren. Mit seinem Ansatz konkretisierte Landauer Bubers Verständnis von Sozialpsychologie, vielleicht überspitzte er es sogar, doch zeigte er die Konsequenzen dieses Ansatzes auf und entwickelte eine sehr ähnliche Idee mit seinem Geistbegriff. Schon die Analyse kollektiver Verhältnisse war für Landauer revolutionär, lege sie doch die zugrundeliegenden Prinzipien frei und öffne damit einen Raum für Veränderungen. – S. 91
Gustav Landauer war kein streng systematischer Denker, er entfaltete sein Werk in punktuellen Beiträgen zu aktuellen Debatten seiner Zeit. Er dachte nach, er dachte mit und er dachte weiter. So veränderten sich auch seine Standpunkte im Laufe der Zeit. Landauers Jüdischsein war für ihn dabei allerdings stets Gegenstand der Auseinandersetzung. Insbesondere nachdem er begann explizit über Jüdinnen:Juden, jüdische Geschichte und Motive öffentlich zu schreiben, wurde er immer mehr von anderen jüdischen Intellektuellen und Denker:innen wahrgenommen. – S. 222
Es zeigt sich hier eine Öffnung, allerdings nicht hin zum Judentum an sich, sondern zu einer als jüdisch verstandenen Überlieferung bzw. Tradition, die es letztlich ermöglichte, ein grösseres Zielpublikum anzusprechen und den Quellenbestand von Mythen, Metaphern und Bildern bzw. Symbolen, zu vergrössern. Landauer entdeckte also in jüdischen Mythen und Traditionen, was er selbst Geist oder Mythos nannte. Konzepte, die er zur Bildung seiner neuen Gemeinschaft seines neuen Volkes brauchte. Lediglich insofern kann von einer Hinwendung zum Judentum gesprochen werden, als dass er im Fundus jüdischer Literatur und Geschichte nach Elementen und Erscheinungsformen seines Geistes suchte und diese auch fand. Landauers symbolischer Anarchismus nutzte zwar jüdische Bilder, Motive und Mythen, doch blieben diese symbolisch wie sein Anarchismus, der sich in dieser Zeit nicht zu einem jüdischen Anarchismus entwickelte. – S. 225
Sebastian Venske: Gustav Landauer als jüdischer Intellektueller? De Gruyter Oldenbourg 2025. 255 Seiten. ca. SFr. 162.00. ISBN: 978-3-11-157712-8.


