Paul Masons: Faschismus. Und wie man ihn stoppt. Antifaschistischer Appell eines Journalisten
Sachliteratur
Zum Einstieg meiner systematischen Einarbeitung in das Themengebiet „Neofaschismus“, las ich Paul Masons Buch Faschismus. Und wie man ihn stoppt (2022).
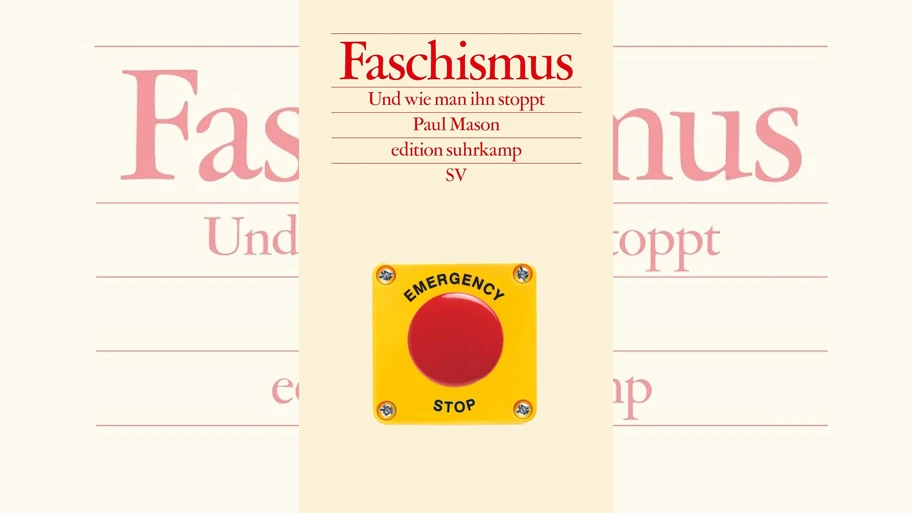
Mehr Artikel
Buchcover.
2
0
Klar und unterstützenswert ist die Aussage Masons, dass der Faschismus neu entstehen kann, bzw. sich bereits längst formiert, wobei er aus einer Fusion von Rechtsextremismus, autoritärem Konservatismus und Rechtspopulismus hervorgeht. Im Zentrum stehen Überlegenheitsgefühle, die mit einer Selbst-Viktimisierung einhergehen (egal, ob es um Weisssein, Männlichkeit, Heterosexualität oder Kolonisation geht).
Der Faschismus beinhalte grundlegend einen Vernichtungswunsch, welcher psychisch an den Wunsch zur eigenen Selbstzerstörung gekoppelt ist. Er befördert den Wunsch, Lügen glauben zu wollen und diese aktiv zu verbreiten. Faschismus dehnt sich aus, wo die Ideologie des liberalen Kapitalismus versagt und staatlich-demokratische Institutionen erodieren. In seinem Buch legt Mason einen Schwerpunkt auf den Prozess, welcher Faschisten an die Staatsmacht bringt, wozu es verschiedene (politikwissenschaftliche, anthropologische, psychiatrische, moralphilosophische) Faschismustheorien zu überdenken gälte. Darüber hinaus müsse festgehalten werden, dass sich die Annahme zwischen den 1960er und 1990er Jahren, der historische Faschismus könne sich nicht wiederholen, als falsch herausgestellt hat. Soweit ist die Herangehensweise Masons nachvollziehbar und fundiert. Gerade der populärwissenschaftlich-journalistische Zugang unterstützt sein Anliegen, die reale Gefahr des Faschismus deutlich zu benennen. Somit gelingt es ihm auch jenseits von scheinbar distanzierten (wissenschaftlichen) Überlegungen eigene Analysekategorien zur Beschreibung faschistischer Projekte zu formulieren. Dabei fokussiert er sich auf faschistische Praktiken, statt den Wust ihrer inkohärenten (und wandelbaren) ideologischen Fragmente überzubewerten oder den Fehler zu begehen, den Neofaschismus lediglich bei den Stiefelnazis zu verorten, wobei Gewalt für ihn dennoch eine wesentliche Rolle spielt.
Man kann die Formierung und Erstarkung neofaschistischer Projekte zudem nicht isoliert von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen begreifen. Zurecht verweist der Autor hierbei auf die (untergehende) neoliberale Herrschaftsordnung, bezieht die Bedeutung des Internets und die wachsende Verbreitung irrationaler Denkmuster ein. Um neofaschistische Vorstellungen zu begreifen, muss man sich mit ihrer verworren-kryptischen Sprache und ihrer Symbolik beschäftigen. Hierbei folgt Mason Roger Griffin mit dem Ansatz, den Faschismus aus seiner eigenen Logik heraus zu erklären.
Im Buch gibt der Autor also einen guten Überblick über verschiedene Faschismustheorien, benennt Faktoren für die Wiedererstehung neofaschistischer Gruppierungen und ihrer Verbreitung in der Bevölkerung. Dabei zieht er Parallelen zum historischen Faschismus (226) – die auf jeden Fall gegeben sind, aber dennoch recht plump vermittelt erscheinen.
Darüber hinaus handelt sich Mason aber verschiedene Probleme in seiner Erzählung und Perspektive ein. Diese sind nicht allein dem geschuldet, dass er ein umfangreiches Thema zugänglich vermitteln möchte, sondern darin begründet, dass er an wichtigen Punkten oberflächlich bleibt. Unter anderem bedient er sich des Ideologiebegriffs von Karl Mannheim, welcher sich insbesondere gegen sozialistische Utopien richtet. Mit seinem Verweis auf die Rationalität der Wissenschaft verkennt Mason, dass diese erstens als Herrschaftsinstitution spezifische Denk- und Wissensformen hervorbringt und ausserdem Ergebnisse produziert, die teilweise den Interessen ihrer staatlichen und privatwirtschaftlichen Geldgeber entsprechen – statt einfach neutral zu sein.
Nachvollziehbar ist, dass Mason Liberale und Linke auffordert, ihre Abneigung gegeneinander zu überwinden und in einer „Volksfront“ gegen den Faschismus Stellung zu nehmen. Dazu beruft er sich aber auch eine „Art von Kapitalismus […] in der nicht der Markt, sondern die menschlichen Bedürfnisse das Wirtschaftsleben regulieren“ (125). In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass Mason nicht bloss strategisch eigene Ansichten zurück hält, um ein breiteres Publikum ansprechen zu können, sondern tatsächlich verkürzten Vorstellungen von der Funktionsweise ökonomischer Systeme anhängt. Ebenso deutlich wird dies in seiner Hoffnung auf einen keynesianischen „Green New Deal“, der stets eine linke Projektionsfläche blieb (132). Mason verkennt, wie andere pseuso-sozialistische Linke, dass der Staat keineswegs so demokratisch beeinflussbar ist, wie er gerne glauben würde. Deswegen geht seine Vorstellung auch nicht auf, dass die Demokratie „verteidigt“ werden müsse, um die Klimakatastrophe zu verhindern und dem Faschismus Einhalt zu gebieten (148).
Wie er am Ende des Buches festhält, gelüstet es den Autoren nach einer Einschränkung von Versammlungs-, Presse- und Meinungsfreiheit für rechtsextreme Akteur*innen (383f.). Dass diese ein schöner Wunschtraum, weil die entscheidenden politischen Machthaber eben kein Interesse haben, Faschist*innen derart zu reglementieren, wohl aber, die Demokratie weiter einzuschränken, ignoriert Mason vehement. Vor allem aber widerspricht er sich dahingehend selbst, wenn er darauf insistiert, dass die Gefahr der Zerstörung von unabhängiger Justiz, akademischer Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sehr real ist, was linksliberale Zeitungen ignorieren würden (226). Durch das Buch hinweg, aber im Verlauf seiner Lektüre immer peinlicher werdend, wird deutlich, dass Mason einer eigenartig naiven Konzeption von „Marxismus“ anhängt, den er wiederholend als eine Art Zauberwort verwendet (170). Diesen stellt er als moralisch gut dar, was zu seiner Forderungen nach einer Wiederentdeckung des „Humanismus“ passt, aus welcher er sich die Entstehung eines „antifaschistisches Ethos“ herbeiwünscht. Durch das Buch hindurch wiederholt Mason die Phrase, dass der Faschismus die „Angst vor der Freiheit“ sei, im Erkennen eines gewachsenen „Wunsches nach Freiheit“ (319). Was immer man in diese Beschwörungsformel hineinprojizieren mag, die Erfahrungen von Aktiven in sozialen Bewegungen sind weit umfangreicher und tiefgründiger als Erichs Frömmelei.
Mit der Gegenüberstellung von Liberalen und „Marxisten“ macht der Autor sozialistische Strömungen und Bestrebungen in ihrer Vielfalt unsichtbar. Zeitgenössischen „Marxist*innen“ rät er dagegen, diese sollten „den Menschen“ statt Klasse oder Kapitalismus in den Mittelpunkt rücken – und schon wäre ihr Kardinalfehler des 20. Jahrhunderts behoben (315). Der grundsätzliche Hintergedanke, dass der Faschismus eben nicht bloss als Agent des Kapitals missverstanden werden können und dass es die „Sozialfaschismusthese“ in alter und neuer Ausprägung konsequent zurückzuweisen gälte, ist dabei sicherlich richtig. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, eine Kritik an der Gesellschaftsform aufzugeben, welche den Faschismus erst hervorbringt. Jene schliesse aber die Kritik an staatlicher Herrschaft ein, die nicht damit weggeredet werden kann, dass manche Menschen eben Hierarchien mögen und nicht auf Veränderungen klarkommen (321).
Fälschlicherweise glaubt Mason, 1917 hätte der „bolschewistische Flügel“ in Russland die Macht ergriffen und diese an die Sowjets „übergeben“ (157) – statt zu sehen, dass die Rätebewegung zunächst völlig unabhängig von den Bolschewisten entstand, von diesen dann entmachtet wurden und als leere Hüllen zur Durchsetzung der Imperative des stalinistisches Staates dienten. Mason übt eine nachvollziehbare Kritik an der Philosophie Friedrich Nietzsches, den er aber fast persönlich dafür verantwortlich macht, irrationales, elitäres und gewaltsames Denken befördert zu haben.
So ist es auch nicht zielführend, dass der Autor glaubt, die Verbreitung des Irrationalismus an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wäre eine Reaktion auf die Entstehung „marxistischer“ Massenparteien gewesen (174). Zwar stimmt es, dass faschistische Gruppen den Fortschrittsgedanken ablehnen (176), jedoch ist dieser in der modernen Gesellschaft durchaus kritikwürdig, sonst hätte es beispielsweise keine faschistische Utopie eines maschinistischen Übermenschen geben können. Auf langweilige Weise wiederholt Mason auch den Mythos, dass Georges Sorel ein entscheidendes Bindeglied von Irrationalismus und Faschismus wäre (180) – obwohl dessen wutbürgerliche und maskulinistische Theorien eher als plumpe Zuspitzung anarcho-syndikalistischer Strategien verstanden werden müssen.
Wie oben dargestellt, ist Masons Buch als Einstieg in die Beschäftigung mit dem Neofaschismus eine gute Grundlage und gibt einen umfangreichen Überblick, der verständlich vermittelt wird. Entscheidende Punkte, die zur Entstehung und Verbreitung des Neofaschismus führen, werden dabei leider nur oberflächlich behandelt. Dass die Kontinuitäten zum historischen Faschismus eindeutig sind, stellt Mason überzeugend heraus. Zugleich verbleibt er bei der Konzeption einer Wiederholung der Geschichte, statt ebenfalls Rahmenbedingungen zu benennen, die sich grundlegend verändert haben. Wenngleich der Appell an eine antifaschistische Positionierung der Lesenden wohlgemeint ist, wird dieser lediglich durch einen weichgespülten Humanismus legitimiert. Nach der Formulierung einer Vision einer alternativen Gesellschaftsform, die den Faschismus verunmöglichen könnte, sucht man vergeblich, obwohl der Autor selbst auf Daniel Guérins Gedanken verweist, dass nur ein „verkörpertes Ideal“ den Faschismus besiegen könne (411).
Paul Masons: Faschismus. Und wie man ihn stoppt. Suhrkamp Verlag 2022. 188 Seiten, ca. 24.00 SFr. ISBN: 9783518029770.


