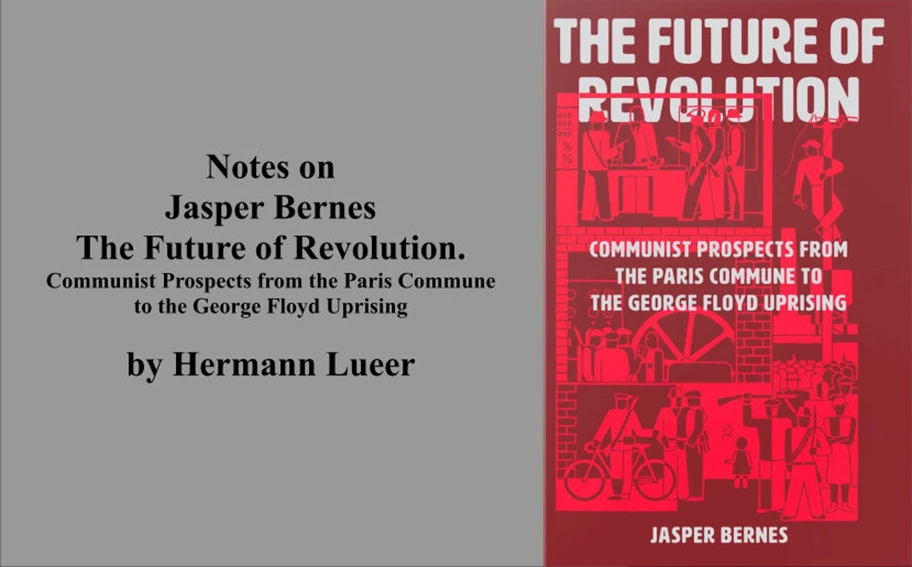Aus Sicht der Grundprinzipien geht Bernes' Kritik am Kern der Sache vorbei. Die Arbeitszeitrechnung ist nicht nur ein Instrument zur Verteilung, sondern die praktische Grundlage, die die umfassenderen Aufgaben des Kommunismus erst ermöglicht. Die Durchsetzung der Arbeitszeitrechnung führt zur Abschaffung der Lohnarbeit und schafft zugleich die Grundlage für die gesellschaftliche Selbstverwaltung. Nur wenn die Produzenten transparent und überprüfbar sehen können, wie viel gesellschaftliche Arbeit in jedem Produkt steckt, können sie ihre Arbeitsteilung bewusst neu organisieren, das Verhältnis zwischen Stadt und Land neu gestalten und die Produktion nach kollektiven Prioritäten planen.
Die Arbeitszeitrechnung ist keineswegs »in der Verteilung gefangen«, sondern sie liefert die gemeinsame materielle Sprache, durch die die Räteorganisationen Produktion und Konsum vereinheitlichen und eine Unterordnung unter die Staats- oder Marktmacht verhindern können. Ohne eine solche Grundlage laufen Appelle zur Neuorganisation der Gesellschaft Gefahr, zu moralischen Ermahnungen oder autoritären Befehlen zu verkommen. In Kapitel 1 mit dem Titel »Arbeiterräte und die kommunistische Perspektive« beginnt Bernes seinen historischen Rückblick auf die Arbeiterräte mit einer Würdigung der Pariser Kommune von 1871. Er erinnert uns daran, dass die Kommune eine Regierung der Arbeiterklasse war, »das Resultat des Kampfs der hervorbringenden gegen die aneignende Klasse, die endlich entdeckte politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte.«[1] Bernes' zentrale These lautet, dass Arbeiterräte, die aus den Prinzipien der Pariser Kommune hervorgegangen sind, weitere historische Einblicke und ewige Wahrheiten über den Klassenkampf liefern, die für die kommunistische Perspektive wertvoll sind. Für Bernes liegt das revolutionäre Potenzial der Räte in der Verschmelzung von Politik und Wirtschaft, in der Verbindung von politischem Aufstand (Zerstörung der Staatsmacht) mit wirtschaftlicher Transformation (direkte Koordination der Produktion durch die Arbeiter). Arbeiterräte dienen somit als Waffe und organisatorisches Mittel, um die ökonomische Emanzipation der Arbeit zu erreichen.
Bernes betont in Bezug auf das historische Scheitern der Rätebewegungen, dass die Räte in Deutschland, Russland, Italien und Spanien entweder politischen oder wirtschaftlichen Einfluss erlangten, aber nicht beides. Die für den Kommunismus notwendige Synthese von Produktion, Verteilung und politischer Entscheidungsfindung wurde nie erreicht, sondern bleibt eine Perspektive. Bernes' Lehre lautet daher nicht, die Räte aufzugeben, sondern sie als eine unvollendete Aufgabe zu verstehen – als die Notwendigkeit einer Form, die Aufstand und Reproduktion, Kommune und Rat, Politik und Wirtschaft vereint.
In Kapitel 2 legt Bernes die theoretische Grundlage für seine Analyse als »ergänzende Lesart des Kapitals« dar, »in der Marx' Meisterwerk nicht nur die adäquate Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise ist, sondern auch eine negative Skizze ihrer Überwindung durch den Kommunismus.« (87) Bernes unterscheidet dabei zwischen zwei Aspekten.
1. Der »Wert-Test« – mit dem er feststellt, ob eine Form der sozialen Organisation das Wertgesetz abschafft. Dieser logische Test »geht von der Definition des Kapitalismus, seiner grundlegenden logischen Struktur, aus, um zu klären, was es bedeuten würde, ihn zu überwinden.« (90)
2. Der »Kommunismus-Test« – der formuliert, was über die Abschaffung des Werts hinaus erreicht werden muss, um zum Kommunismus überzugehen. Dazu gehört die Überwindung des Staates, der Klassen, des Geldes und der Arbeitsteilung (zwischen geistiger und körperlicher Arbeit sowie zwischen Stadt und Land).
Für Bernes ist die Abschaffung des Werts eine notwendige, wenn auch nicht ausreichende Voraussetzung für den Kommunismus. In seinem Essay betont er, dass eines seiner Hauptziele darin besteht, »zu zeigen, dass der »Wert-Test« nicht der »Kommunismus-Test« ist und dass die Verwechslung der beiden Begriffe die Aufgaben des Kommunismus grundlegend verschleiert.« (109) In Bernes' Testaufbau existieren die beiden Komponenten – die wirtschaftliche Basis (Wert-Test) und die politische Struktur (Kommunismus-Test) – als getrennte, rein formale Testkriterien. Im Gegensatz dazu hat Karl Marx gezeigt, dass die wirtschaftliche Grundlage einer Gesellschaft – ihre Produktionsverhältnisse und Produktionsmittel – für ihre Entwicklung von grundlegender Bedeutung ist. Diese Grundlage hat einen erheblichen Einfluss auf den politischen Überbau, einschliesslich Staat, Recht, Kultur, Moral und Religion. Die wirtschaftlichen Produktionsverhältnisse sind die treibende Kraft, die den politischen und kulturellen Ausdruck einer Gesellschaft prägt. Dies gilt auch für die soziale Revolution.
Die Abschaffung der Lohnarbeit und der durch Waren und Werte vermittelten sozialen Beziehungen führt zu einer Neuordnung der politischen Struktur. Bernes lehnt Marx' Verbindung zwischen Basis und Überbau zwar nicht ausdrücklich ab, sein dualer Testrahmen behandelt jedoch die wirtschaftlichen und politischen Dimensionen des Kommunismus als getrennte formale Kriterien. Damit läuft er Gefahr, Marx' Erkenntnis ausser Acht zu lassen, dass die Transformation der Produktionsverhältnisse bereits den politischen Überbau umgestaltet und damit den Staat und die Klassenherrschaft untergräbt, die mit den antagonistischen Produktionsverhältnissen zusammenhängen. Diese theoretische Schwäche wird im weiteren Verlauf seiner Analyse deutlich, wenn Bernes seinen Test auf fünf verschiedene Formen der sozialen Organisation anwendet.
1. Die Idee der Arbeitsbanken und des Arbeitsgeldes, die von den sogenannten utopischen Sozialisten (Proudhon, Darimon, Grey und Lassalle) vorgeschlagen wurde und unter den Stichworten »fairer Handel« und »faire Löhne« bis heute Anhänger findet.
2. Das Konzept der Arbeitszertifikate, das von Marx und Engels lediglich skizziert und von der Gruppe Internationaler Kommunisten zu einem umfassenden Konzept der Arbeitszeitrechnung weiterentwickelt wurde.
3. Amadeo Bordigas Diktatur des Proletariats unter der Führung der Kommunistischen Partei.
4. Giles Dauvés Formulierung der Revolution als Prozess der Kommunisierung. 5. Paul Matticks Plädoyer für Rationierung statt Arbeitszeitrechnung.
1. Marx gegen Arbeitsgeld
In seiner Kritik an der Idee des fairen Handels und des wahren (fairen) Arbeitswerts bezieht sich Karl Marx auf seine Erklärung, wie die kapitalistische Produktionsweise funktioniert. Wenn private Produzenten unabhängig voneinander für den Markt arbeiten, entsteht der gesellschaftliche Zusammenhang ihrer Arbeit erst, wenn ihre Arbeit und ihre Produkte im Verhältnis zur durchschnittlichen gesellschaftlichen Arbeit bewertet werden. Ihr gesellschaftlicher Zusammenhang kommt nicht durch bewusste, geplante Zusammenarbeit zustande, sondern hinter ihrem Rücken durch den Wettbewerb. Sie kontrollieren ihre Arbeit nicht gemeinsam, sondern unterwerfen sich ihrer Bewertung auf dem Markt.In einer Gesellschaft von Warenproduzenten ist daher das durch den Wettbewerb durchgesetzte Wertgesetz die einzig mögliche Organisationsstruktur dieser Produktionsweise. Nur durch die Aufwertung oder Abwertung ihrer Waren werden die einzelnen Warenlieferanten sich dessen bewusst, was die Gesellschaft braucht und in welchem Umfang. Befürworter des fairen Handels wollen genau diesen einzigen Regulator einer kapitalistischen Warenproduktion abschaffen oder sozial verändern. In seinem Vorwort zu Marx' Das Elend der Philosophie kommentiert Friedrich Engels diese Utopie polemisch: So wie der Katholizismus nicht durch die Ernennung des »wahren« Papstes abgeschafft werden kann, können die Folgen der kapitalistischen Warenproduktion nicht durch die Festlegung des »wahren Werts« beseitigt werden.
2. Die Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung
Marx und Engels' Aussagen scheinen auf den ersten Blick widersprüchlich zu sein. Einerseits kritisierten sie scharf die Arbeitsgeldsysteme der sogenannten utopischen Sozialisten, die glaubten, dass Ausbeutung überwunden werden könne, wenn Waren einfach zu ihrem »wahren Wert«, gemessen in Arbeitszeit, getauscht würden. Andererseits skizzierten sie in Texten wie der Kritik des Gothaer Programms oder Engels' Anti-Dühring eine kommunistische Gesellschaft, in der die Arbeitszeit als allgemeine Rechnungseinheit dient und die Individuen Arbeitszertifikate erhalten, die ihren Arbeitsbeitrag widerspiegeln. Dies wirft die Frage auf: Wie kann die Arbeitszeit in einem Kontext als Utopie abgelehnt und in einem anderen als unverzichtbares Prinzip des Kommunismus begrüsst werden?In seiner Abhandlung über die Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung zeigt Bernes, dass sich der scheinbare Widerspruch bei genauerer Betrachtung als unbegründet erweist. Wie von Marx und Engels skizziert und von der GIK weiterentwickelt, unterscheidet sich die Arbeitszeitrechnung von dem Ansatz der sogenannten utopischen Sozialisten dadurch, dass sie von vergesellschafteten Produktionsmitteln ausgeht. Folglich sind Güter keine Waren mehr, die erst auf dem Markt ihre gesellschaftliche Anerkennung erlangen, sondern von Anfang an gesellschaftliche Produkte. Anstatt sie auf einem Markt zu handeln, produzieren und verteilen die Gesellschaftsmitglieder die Güter entsprechend ihrer Bedürfnisse.
Zu diesem Zweck wägen die Individuen ihre Bedürfnisse gegen den entsprechenden Arbeitsaufwand ab, den die Gesellschaft benötigt, und bringen sie durch Aufträge und ihre entsprechende Arbeitsbereitschaft in den gesellschaftlichen Planungsprozess ein. Auf der Grundlage vergesellschafteter Produktionsmittel sind Arbeitszertifikate ein Mittel zur Koordinierung der Arbeitsteilung in der gemeinsamen Planung. Die Arbeitszeitrechnung ist Produktionsplanung. Sie bringt die zur Befriedigung individueller Bedürfnisse erforderliche gesellschaftliche Arbeitszeit mit der entsprechenden individuellen Arbeitsbereitschaft in Einklang.
Produktion und Konsum werden so für alle transparent in einem Abrechnungssystem, das Bernes als »offene Bücher« beschreibt und das laut Marx in der Tat nichts anderes wäre als ein Gremium, »was für die gemeinsam arbeitende Gesellschaft Buch und Rechnung führte.«[2] Jedes Gesellschaftsmitglied erfasst seine Arbeitsstunden und jedes Produkt wird mit den gesellschaftlich durchschnittlich für seine Herstellung erforderlichen Stunden gekennzeichnet. Zunächst werden vom gesamten gesellschaftlichen Produkt Abzüge für öffentliche Güter, Reserven und Arbeitsunfähige vorgenommen. Der verbleibende Anteil steht dem individuellen Verbrauch proportional zur geleisteten Arbeitszeit zur Verfügung – unabhängig von der individuellen Produktivität.
Das bedeutet, dass die Arbeitszeitrechnung nicht lediglich ein technisches Instrument ist, sondern ein Grundprinzip des Kommunismus. Sie ermöglicht einen Übergang von der Marktbeherrschung zur bewussten Selbstorganisation. In einem kapitalistischen System erscheint die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit nur indirekt als Geldwert, der durch den Wettbewerb gebildet wird und die Produzenten durch Gewinn und Verlust diszipliniert. Im Kommunismus hingegen wird die Arbeitszeit direkt berechnet. Die Gesellschaft kann bestimmen, wie viele Arbeitsstunden in eine Maschine, eine Tonne Weizen oder ein Stück Stoff investiert werden – ohne Umwege über den durch den Marktwettbewerb bestimmten und in Geld ausgedrückten Wert. Das bedeutet, dass die individuelle Arbeit eine unmittelbare gesellschaftliche Anerkennung in Form von Zeit erhält, die nicht durch Preise verschleiert wird.
Bernes betont, dass Transparenz für dieses System von entscheidender Bedeutung ist. Die Arbeitszeitrechnung beseitigt den Fetischismus des Werts. Anstatt unsichtbar vom Markt bestimmt zu werden, werden die Preise bewusst von Arbeiterräten entsprechend der durchschnittlichen gesellschaftlichen Produktivität festgelegt. Damit wird das Wertgesetz überwunden, also das fremde, zwanghafte Mass, das sich aus dem kapitalistischen Wettbewerb ergibt. Die Arbeitszeitrechnung im Kommunismus ist also keine Rückkehr zum Wertbegriff, sondern vielmehr dessen Gegenteil. Arbeitszertifikate sind kein Geld. Sie zirkulieren nicht, werden nicht akkumuliert und vermitteln keinen Austausch zwischen privaten Eigentümern. Stattdessen werden damit lediglich Arbeitsbeiträge erfasst, worüber sicherzustellt wird, dass jeder nach allgemeinen Abzügen den Anteil am gemeinsamen Produkt erhält, der seinem Beitrag entspricht. Damit wird die Aneignung fremder Arbeit über Lohnarbeit abgeschafft und Arbeit wird als Beitrag jedes Einzelnen zur kollektiven Produktion gesellschaftlich anerkannt. Das System gewährleistet somit Gleichheit und Zusammenarbeit.
Unterschiede in der individuellen Produktivität führen nicht mehr zu einer ungleichen Konsumverteilung. Überschüsse und Defizite werden im Hauptbuch der öffentlichen Rechnungslegung gesellschaftlich ausgeglichen. Technische Verbesserungen reduzieren die durchschnittliche Zeit, die zur Herstellung von Gütern benötigt wird, und alle profitieren von kürzeren Arbeitszeiten oder grösserem kollektiven Wohlstand. Wettbewerb und Zwang weichen Zusammenarbeit und gemeinsamem Fortschritt.
Vor diesem Hintergrund löst sich der scheinbare Widerspruch in den Aussagen von Marx und Engels zu »Arbeitsgeld« und »Arbeitszeitrechnung« auf. Sie lehnten utopische Arbeitsgeldmodelle ab, da diese im Rahmen der Warenproduktion und des Warenwerts verblieben. Sie befürworteten jedoch die Arbeitszeitrechnung im Kommunismus, da diese unmittelbar gesellschaftliche Arbeit voraussetzt und sowohl die Warenform als auch das Geld abschafft. Bernes räumt ein, dass die GIK diesen Unterschied besser verstanden hat als alle ihre Zeitgenossen. Sie haben den »Wert-Test« bestanden. Ihr Vorschlag macht die Arbeitszeit zu einem klärenden Massstab statt zu einem Fetisch und verwandelt sie in ein Instrument der demokratischen Selbstorganisation statt in eine externe Zwangsmassnahme.
3. Bordiga gegen die GIK
Bernes weist darauf hin, dass sich Bordiga nie zu den Grundprinzipien der Gruppe Internationaler Kommunisten geäussert hat. Offensichtlich war er »nicht in der Lage, zwischen den von Marx kritisierten mutualistischen Arbeitsgeldsystemen, bei denen Produktionsgüter ausgetauscht werden, und Arbeitszertifikatsystemen, bei denen lediglich der Konsum organisiert wird, zu unterscheiden.« (105) Aufgrund seiner Erfahrungen in Italien setzte Bordiga darüber hinaus Arbeiterräte generell mit Syndikalismus und Genossenschaftswesen gleich. Laut Bernes führte dieser einseitige Bezug auf die Arbeiterräte zusammen mit Bordigas Missverständnis von Marx' Werttheorie zu seinem Schluss, dass selbst bei einer Organisation der Produktion durch Arbeiterräte Märkte und Geld weiterhin notwendig wären, da nur ein allgemeines Äquivalent die komplexe, dezentrale Produktion koordinieren könne. Um die vermeintliche Tendenz zur Fragmentierung und zu Märkten zu überwinden, bestand Bordiga daher auf einer radikalen Vereinigung der Gesellschaft unter der kommunistischen Partei. Unter ihrer Führung wären die Individuen nicht frei, ihre Arbeit oder ihren Konsum zu wählen. Diese Entscheidungen würden stattdessen »im Interesse der Gesellschaft« diktiert – zunächst durch die Diktatur der revolutionären Partei und später durch die »Gesellschaft als Ganzes« –, sobald die Individualität selbst aufgelöst worden sei.Ironischerweise wird Bordigas Vision einer klassenlosen, geldlosen und staatenlosen Gesellschaft durch sein Missverständnis von Marx' Werttheorie auf den Kopf gestellt. Laut Bernes' »Wert-Test« schafft Bordiga Wert und Geld lediglich dem Namen nach ab, ohne einen Mechanismus zur bewussten Koordination vorzusehen. Er macht keine konkreten Angaben dazu, wie eine sofortige Abschaffung des Geldes in der Praxis funktionieren würde. Folglich schlägt er eine »Naturalwirtschaft« vor. Oberflächlich betrachtet scheint dies ein radikaler Bruch mit dem Kapitalismus zu sein. In der Praxis schafft sie jedoch Bedingungen, die eine rationale Planung untergraben und die Gesellschaft in kapitalistische Verhältnisse zurückdrängen. Da es kein gemeinsames Mass zum Vergleich verschiedener Inputs und Outputs gibt, werden Produktions- und Konsumentscheidungen willkürlich getroffen.
Eine »Naturalwirtschaft« bedeutet somit die Abschaffung der Rationalität in der Wirtschaft. Ohne rationale Kalkulation birgt Bordigas »Naturalwirtschaft« die Gefahr, Chaos zu verursachen. Wie Bernes andeutet, könnte dieses Modell leicht in Autoritarismus und die Wiedereinführung von Wertverhältnissen abgleiten, wie es in der Geschichte der Sowjetunion zu beobachten war.
Trotz Bernes' Kritik an Bordigas Behauptung, dass von Arbeiterräten geführte Betriebe die Wiederherstellung des Wertgesetzes erfordern würden, argumentiert Bernes, dass Bordigas negative Definition des Kommunismus – eine klassenlose, geldlose und staatenlose Gesellschaft – die Grundprinzipien der GIK vor ernsthafte Herausforderungen stellt. Laut Bernes ist Bordigas Kritik nicht deshalb wertvoll, weil sie »Wert« in Rätesystemen »entdeckt«, sondern weil sie die unvollendeten Aufgaben des Kommunismus über die Abschaffung des Werts hinaus betont. Bernes würdigt den Beitrag der GIK, insbesondere ihren Vorschlag einer »offenen« Buchhaltung. Er kritisiert die GIK jedoch dafür, dass sie davon ausgeht, der Kommunismus folge automatisch auf die Abschaffung des Werts, ohne die weiteren Aufgaben der sozialen Transformation anzusprechen.
Für Bernes ist die Abschaffung des Werts notwendig, aber nicht ausreichend. Zertifikate »überdecken« seiner Meinung nach lediglich die tiefere Kluft zwischen Produktion und Konsum. Die Arbeiter würden Rechte an Produkten auf der Grundlage ihrer Arbeitsstunden erhalten. Die Produktionsentscheidungen blieben jedoch weiterhin fragmentiert auf die einzelnen Arbeitsstätten verteilt und würden erst nach Beginn der Produktion getroffen. Der Kommunismus hingegen erfordert, dass die Gesellschaft gemeinsam vor Beginn der Produktion festlegt, was und wie produziert werden soll. Arbeitszeitzertifikate mögen zwar den Konsum koordinieren, lösen aber seiner Ansicht nach die strukturelle Fragmentierung der Arbeiterräte nicht.
Bernes' »Kommunismus-Test« ist wertvoll, da er uns daran erinnert, dass die Abschaffung des Werts nicht die einzige Aufgabe der Emanzipation ist. Der Test unterstreicht die Notwendigkeit, die aus dem Kapitalismus übernommene Arbeitsteilung zu überwinden. Es stimmt, dass sich der Kommunismus nicht allein auf Buchhaltungstechniken reduzieren lässt. Er erfordert eine vollständige Umgestaltung des sozialen Lebens. Wie oben erwähnt, bleibt Bernes' Kritik jedoch zu formalistisch. Er behandelt die wirtschaftlichen und politischen Aspekte des Kommunismus als getrennte Prüfkriterien und betrachtet die Abschaffung des Werts und die Abschaffung des Staates als zwei voneinander unabhängige Aufgaben. Damit ignoriert er Marx' grundlegende Erkenntnis, dass die wirtschaftliche Basis der Gesellschaft – ihre Produktionsverhältnisse – ihren politischen Überbau prägt und bestimmt. Die Abschaffung der Lohnarbeit und die damit verbundene Vergesellschaftung der Produktionsmittel beseitigen Klassengegensätze, wodurch auch die staatlichen Funktionen einer antagonistischen Gesellschaft absterben.
Die Arbeitszeitrechnung ist eine Waffe gegen die Lohnarbeit. Durch die Ausstellung von Arbeitszertifikaten, die proportional zu den geleisteten Arbeitsstunden vergeben werden, wird der Warencharakter der Arbeitskraft beseitigt. Die Arbeiter sind nicht mehr von den Früchten ihrer Arbeit getrennt, sondern ihr Beitrag und ihr Anteil sind transparent miteinander verknüpft. Diese unmittelbare Gleichheit im Verhältnis zwischen Produzenten und ihren Produkten schafft die Grundlage für tiefgreifendere Veränderungen der Arbeitsteilung, der Trennung zwischen Stadt und Land sowie der sozialen Beziehungen. Die GIK leugnet keineswegs die Notwendigkeit dieser umfassenderen Veränderungen. Sie betont jedoch, dass solche Veränderungen ohne eine transparente gesellschaftliche Rechnungslegung keine Stabilität und keine Richtung hätten. In diesem Sinne zielen die Grundprinzipien nicht darauf ab, die Politik durch die Wirtschaft zu ersetzen. Vielmehr stellen sie sicher, dass alle neu entstehenden Ausschüsse innerhalb der Räteorganisation auf einer transparenten und kollektiv überprüfbaren Grundlage arbeiten.
Aus der Perspektive der Grundprinzipien entsteht der Kommunismus nicht im luftleeren Raum, sondern basiert auf einer rationalen Beziehung zwischen Produzenten und ihren Produkten. Ohne eine objektive und transparente Methode, um gesellschaftliche Arbeit und gesellschaftlichen Konsum in Beziehung zu setzen, verliert die politische Debatte ihren Anker. Sie verkommt zu Behauptungen, moralischen Appellen oder Machtkämpfen – genau die Dynamik von versteckter Macht und Willkür, die der Kommunismus abschaffen will. Für die GIK ist die Arbeitszeitrechnung daher kein Ersatz für Politik. Sie ist vielmehr eine gemeinsame Sprache, durch die sinnvolle Politik überhaupt erst betrieben werden kann. Durch die Offenlegung der tatsächlichen gesellschaftlichen Kosten von Gütern und Dienstleistungen ermöglicht die Arbeitszeitrechnung den Produzenten, auf verständliche und kollektiv überprüfbare Weise über Prioritäten zu beraten.
Anton Pannekoek, der eng mit der GIK verbunden war, drückte in seinem Werk Die Arbeiterräte den notwendigen Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik wie folgt aus: »In der kollektiven Produktion ist die Buchhaltung öffentlich, jeder Beteiligte hat immer einen vollständigen Überblick über den Verlauf des gesamten Prozesses. Nur so sind sie in der Lage, in den Abteilungsversammlungen und in den Betriebsausschüssen zu diskutieren und zu entscheiden, was zu tun ist. … Sie drückt aus, wie die Menschheit ihre eigenen Lebensprozesse überwacht und geistig steuert; sie macht sichtbar, was Arbeiter und Arbeiterräte als geplante Ordnung aufstellen und umsetzen. Weil sie öffentlich und immer vor aller Augen ist, macht sie zum ersten Mal die Leitung der gesellschaftlichen Produktion durch die Produzenten selbst zur Realität.«[3]
Indem Bernes den »Kommunismus-Test« vom »Wert-Test« trennt, läuft er Gefahr, die Politik von ihrer materiellen Grundlage zu lösen. Zwar fordert er eine staatenlose, geldlose und klassenlose Gesellschaft sowie die Überwindung der vom Kapitalismus übernommenen Arbeitsteilung, jedoch übersieht er, dass Politik von unten nicht nur aus politischen Diskussionen und Handzeichen bestehen kann. Arbeiterräte müssen auf einer rationalen, materiellen Grundlage aufgebaut sein. Die Arbeitszeitrechnung bietet genau diese Grundlage. Sie macht den gesamten Produktionsprozess für alle nachvollziehbar und verhindert einen Rückfall in Märkte oder bürokratische Befehlsstrukturen. Sie gibt den assoziierten Produzenten die Möglichkeit, Konsum und Produktionsbedingungen bewusst zu organisieren.
Die Grundprinzipien betonen, dass die Arbeitszeitrechnung ein Mittel und kein Zweck ist. Sie »leitet nicht die Gesellschaft«. Vielmehr ermöglicht sie es, die Herrschaft über Menschen durch die Verwaltung von Dingen und die Steuerung von Produktionsprozessen zu ersetzen. Die Arbeitszeitrechnung ist kein Ersatz für soziale Interaktion, sondern bietet eine rationale und transparente Grundlage für die freie Interaktion unter Gleichen. Dies – und nicht Bernes' abstrakter Formalismus – sichert die Grundlage, auf der die Vereinigung freier und gleicher Produzenten beraten und die Gesellschaft verändern kann.
4. Dauvé: Räte ohne Arbeiter im Land, in dem Milch und Honig fliessen
Im vierten Teil untersucht Bernes Gilles Dauvé und die nach 1968 in Frankreich entstandene Kommunisierungsbewegung. Bernes argumentiert, dass Dauvé die Kritik an der Räteorganisation radikalisiert, indem er behauptet, dass Räte den Kommunismus nicht verkörpern, sondern vielmehr Gefahr laufen, zu kapitalistischen Organen der Selbstverwaltung zu werden. Ein Rat, der weiterhin als Arbeitseinheit fungiert, reproduziert die Logik der Warenproduktion. Die Arbeiter würden sich zwar selbst verwalten, aber der Reproduktion der Arbeitskraft untergeordnet bleiben. Laut Dauvé ist nicht die Organisationsform, sondern der Inhalt der Revolution entscheidend. Der Kommunismus erfordert demnach die sofortige Abschaffung von Lohnarbeit, Geld und Staat, statt diese in Übergangsformen zu erhalten.Bernes schätzt diese Perspektive. Dauvé stellt klar, dass der Kommunismus nicht als schwer fassbares Ziel, sondern als fortlaufender Transformationsprozess betrachtet werden sollte. Laut der Kommunisierungstheorie ist die Revolution selbst der Kommunismus in Bewegung. Massnahmen wie freier Zugang, das Ende der Lohnarbeit und die Überwindung der Trennung zwischen Arbeit und Leben müssen von Beginn einer Revolte an umgesetzt werden. Laut Bernes ergänzt Dauvés Kritik Bordigas »Kommunismus-Test«, vermeidet jedoch dessen autoritären Ansatz. Während Bordiga die freie Vereinigung der Produzenten durch den Willen der Partei ersetzte, begründet Dauvé die Emanzipation in der spontanen Selbstaktivität der aufständischen Massen.
Bernes verweist aber auch auf den Schwachpunkt von Dauvés Theore. Seiner Ansicht nach vermischt Dauvé den »Kommunismus-Test« mit dem »Wert-Test«. Da Dauvé behauptet, dass die Arbeitszeitrechnung notwendigerweise den Wert reproduziert, unterscheidet er nicht zwischen dem fetischisierten Wert im Kapitalismus und der transparenten Rechnungslegung im Kommunismus. Bernes bezeichnet Dauvés »Kommunismus-Test« daher als leere Negation. Der Kommunismus ist durch die Abschaffung des Werts definiert, doch Dauvé sagt wenig über die positiven Mechanismen der Selbstorganisation, die es den Produzenten ermöglichen würden, ihr gemeinsames Leben zu gestalten. Somit bestehe die Gefahr, dass die Kommunisierung eher zu einem Slogan als zu einer konkreten Möglichkeit wird.
Aus Sicht der GIK liegt das Problem jedoch noch tiefer. Sie würde zustimmen, dass die Abschaffung von Lohnarbeit und Wert sofort erfolgen muss. Diese erfordert jedoch eine positive Grundlage: die Durchsetzung der Arbeitszeitrechnung. Die Verwendung der individuellen Arbeitszeit als Massstab für den Anteil eines Arbeiters am Produkt der gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeit macht Ausbeutung unmöglich und führt somit zur Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Dies bricht mit dem kapitalistischen Produktionsverhältnis, in dem der Anteil des Produzenten nicht durch die tatsächliche Menge seiner Arbeitsleistung, sondern durch den Wert seiner Arbeitskraft – d. h. durch den Markt oder einen administrativ festgelegten Lohn – bestimmt wird. Durch die Durchsetzung der Arbeitszeitrechnung gewinnen die Produzenten die Kontrolle über die Verteilungs- und Produktionsbedingungen zurück.
Die Arbeitszeitrechnung ist daher unverzichtbar, damit die Individuen in einer arbeitsteiligen Gesellschaft ihre Arbeitszeit und -bedingungen sowie ihren entsprechenden Anteil am gesellschaftlichen Produkt selbst bestimmen können. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Selbstbestimmung der Gesellschaftsmitglieder keine leere Rhetorik bleibt. Ohne diese Grundlage wird Dauvés Vision zu einer Fantasie von einer Gesellschaft, in der »Milch und Honig fliessen«, in der Bedürfnisse erfüllt werden und sich die Ressourcen spontan anpassen.
Wie Bordiga missversteht auch Dauvé Marx' Wertkonzept. Wert ist nicht abstrakte Arbeit bzw. Arbeitszeit an sich, sondern vielmehr Arbeitszeit, die durch den Markt autonom wird und die Produzenten »hinter ihrem Rücken« beherrscht. Im Kommunismus ist die Arbeitszeitrechnung nicht wertbezogen, da sie auf vergesellschafteten Produktionsmitteln beruht, die bewusst verwaltet und überprüft werden können. Indem Dauvé Arbeitszeitrechnung mit dem Wert gleichsetzt, negiert er die materielle Grundlage, die notwendig ist, damit der Kommunismus über ein Ideal hinaus existieren kann.
Aus diesem Grund wäre die Kritik der GIK an der Kommunisierung schärfer als die von Bernes. Sie würden argumentieren, dass Dauvé ähnlich wie Bordiga durch die Ablehnung jeglicher Form der Rechnungslegung der wirtschaftlichen Irrationalität und versteckten Zwangsmassnahmen Tür und Tor öffnet. Ohne eine transparente Messung von Aufwand und Ergebnis würden Fragen zu Produktion und Verteilung unweigerlich durch Autorität, Tradition oder Knappheit gelöst werden. Somit würde die Abschaffung des Werts paradoxerweise neue Formen der Herrschaft hervorbringen, seien sie chaotisch oder autoritär. Der Zusammenbruch der Naturalwirtschaft nach der Russischen Revolution, gefolgt von der Einführung der »Neuen Ökonomischen Politik« als Notmassnahme, sollte als Warnung dienen.
Während Bernes die abstrakte Natur von Dauvés Kommunismus anerkennt, betont die GIK die Notwendigkeit eines konkreten Mechanismus der Selbstorganisation. Die Arbeitszeitrechnung ist kein Fetisch, sondern die materielle Sprache, durch die eine freie Gesellschaft ihre Prioritäten beraten kann. Sie schafft die Lohnarbeit ab, durchleuchtet den gesamten Produktionsprozess und stellt sicher, dass die Politik in der bewussten Tätigkeit der Produzenten verankert bleibt. Ohne sie bleibt die Kommunisierung lediglich ein Versprechen der Freiheit.
5. Paul Matticks berühmte Einleitung zur Neuauflage der Grundprinzipien von 1970
Ende der 1960er Jahre hatte Paul Mattick seine frühere Unterstützung für die Arbeitszeitrechnung der GIK aufgegeben. In der Einleitung zur deutschen Neuauflage der Grundprinzipien aus dem Jahr 1970 argumentierte er, dass die Entwicklung der Produktivkräfte ein solches System überflüssig und unpraktisch gemacht habe. Laut Mattick habe der Kapitalismus bereits einen Punkt erreicht, an dem die meisten Güter als frei verfügbare Gebrauchswerte betrachtet werden könnten, die keiner Regulierung durch eine Arbeitszeitrechnung bedürfen. Selbst wenn die Knappheit fortbestehen sollte, hielt er Arbeitszertifikate für überflüssig. In solchen Fällen schlug er vor, dass frei assoziierte Produzenten den Verbrauch direkt rationieren könnten, ohne den Zugang daran zu knüpfen, wie viele Arbeitsstunden geleistet wurden.Matticks Argument wäre tatsächlich stichhaltig, wenn menschliche Arbeit für die Bedürfnisbefriedigung nicht mehr erforderlich wäre, also unter Bedingungen von extremem Überfluss. Sobald die Arbeit gegen Null tendiert, entfällt natürlich auch die Arbeitszeitrechnung, denn ohne Arbeit gibt es keine Arbeitszeit, die zu berechnen wäre. In diesem Stadium wird der Kommunismus als Produktionsverhältnis überflüssig, da sich die Bedürfnisse in einer Gesellschaft, in der »Milch und Honig fliessen«, selbst regulieren. Allerdings waren solche Bedingungen 1970 noch nicht erreicht und auch heute noch nicht.
Solange Arbeit notwendig ist, wird die Arbeitszeitrechnung ein unverzichtbares Instrument der Arbeiter-Selbstverwaltung bleiben. Sie schafft eine Grundlage für Entscheidungen, die auf einer objektiven und transparenten Messung des gesellschaftlichen Aufwands beruhen, und verbindet Produktion und Konsum auf eine Weise, die kollektiv überprüft werden kann. Sie offenbart die tatsächlichen Kosten der kollektiven Tätigkeit der Produzenten und ermöglicht ihnen eine rationale Steuerung der Produktion. Dieses Instrument vorschnell abzulehnen, wie Mattick es vorschlägt, lässt die Produzenten schutzlos zurück. Ohne transparente Buchführung werden Entscheidungen über die Verteilung von selbsternannten Vertretern der assoziierten Produzenten getroffen – von Experten, Bürokraten und Moralisten.
Das Ergebnis ist ein Rückfall in die Rationierung durch Autoritäten und die Auferlegung von Moralkodizes – das genaue Gegenteil von freier Assoziation. Daher ist die Verteidigung der Arbeitszeitrechnung keine Nebensache. Es geht um die Verteidigung der Macht der Arbeiter – darum, sicherzustellen, dass sie selbst und nicht Märkte, Bürokraten oder moralische Autoritäten über ihre Lebensbedingungen entscheiden.
Schlussfolgerung
Bernes' Unterscheidung zwischen dem »Wert-Test« und dem »Kommunismus-Test« verdeutlicht die emanzipatorischen Anforderungen im Hinblick auf die soziale Revolution. Indem er die »ökonomischen« und »politischen« Dimensionen des Kommunismus jedoch als getrennte formale Kriterien behandelt, übersieht er, dass die Durchsetzung der Arbeitszeitrechnung zugleich die Etablierung eines neuen, von der Arbeiterklasse selbst verwalteten Produktionsverhältnisses bedeutet. Bernes untersucht daher auch nicht, inwiefern diese Transformation die Grundlage für die Umgestaltung der politischen Formen legt, die das kapitalistische Produktionsverhältnis hinterlassen wird. Stattdessen propagiert Bernes die Kommunismusvorstellungen von Bordiga, Dauvé und Mattick, die direkt oder indirekt auf Rationierung als Folge der Naturalwirtschaft setzen.Rationierung ist das Gegenteil von Arbeiterselbstverwaltung. Sie öffnet das Feld für Bürokraten, Moralisten und Parteien, die behaupten, die »Interessen der Arbeiterklasse« zu vertreten. Im Gegensatz dazu hat uns die revolutionäre Arbeiterklasse eine andere Botschaft hinterlassen:
»Darum erheben wir als direkte Losung der Arbeitermacht: Die Arbeiter bringen alle gesellschaftlichen Funktionen unter ihre direkte Verwaltung. Sie ernennen alle Funktionäre und setzen sie ab. Die Arbeiter nehmen die gesellschaftliche Produktion in eigene Bewirtschaftung durch Zusammenschliessung in Betriebsorganisationen und Arbeiterräten. Sie selbst schalten ihren Betrieb bei der kommunistischen Wirtschaft ein, indem sie ihre Produktion nach der gesellschaftlich-durchschnittlichen Arbeitszeit berechnen. Damit geht die ganze Gesellschaft zur kommunistischen Produktion über.
Es gibt also nicht Betriebe, die »reif« sind für gesellschaftliche Bewirtschaftung, und Betriebe, die noch nicht »reif« sind. Das ist das politische und zugleich wirtschaftliche Programm der Lohnarbeiter; in diesem Sinne werden ihre Räte die Wirtschaft umgestalten. Es sind die höchsten Forderungen, die wir in diesen Fragen stellen können, aber es sind zugleich auch die niedrigsten, weil es sich handelt um das Sein oder Nicht-Sein der proletarischen Revolution.« [4]