Hans Diefenbacher (Hrsg.): Anarchismus. Zur Geschichte und Idee der herrschaftsfreien Gesellschaft. Terrorismus und politischer Anarchismus im Kaiserreich
Sachliteratur
Der Rechtswissenschaftler Wolfgang Bock behandelt in dem Buch von Diefenbacher den Terrorismus und politische[n] Anarchismus im Kaiserreich und zeichnet seine „Entstehung, Entwicklung, rechtliche und politische Bekämpfung“ nach.
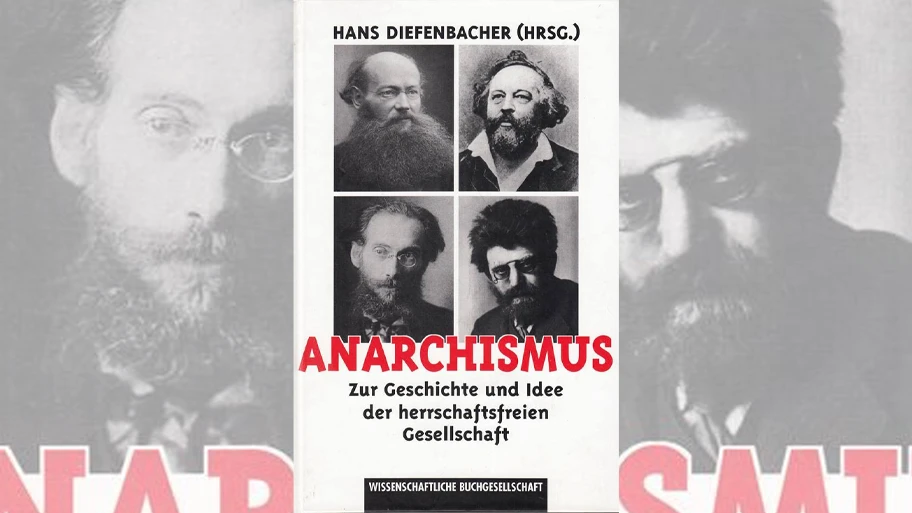
Mehr Artikel
Buchcover.
1
0
Dabei lässt der Autor durchblicken, dass er kein Fan von „Terrorismus“ ist – was allerdings bereits die Frage aufwirft, ob seine Definition davon brauchbar ist. So sind etwa die vier Attentate auf den Kaiser Wilhelm I. durch Oskar Becker, Max Hödel, Karl Eduard Nobiling oder August Reinsdorf zwar durchaus davon motiviert gewesen, Propaganda durch die Tat zu machen. Eine Terrorisierung der Bevölkerung, um unter dieser Panik zu schüren, wurde allerdings nicht angestrebt.
Im Beitrag wird deutlich, dass die Entstehung des expliziten Anarchismus in Deutschland (anders als in den meisten anderen Ländern) als Ausgrenzung und Abgrenzung zur Sozialdemokratie zu verstehen ist. Der Obrigkeitsstaat trug selbst zur Entstehung des Anarchismus und der Gewaltsamkeit einiger Aktionen bei, indem er durch die „Sozialistengesetze“ (1878-1890) eine Spaltung der sozialistischen Bewegung beförderte. Die pauschale Diffamierung gemässigter Sozialdemokraten erzeugte permanenten Druck, sodass jene sich vehement von den späteren Anarchisten abgrenzten und sich parlamentarisch-konform einhegen liessen. Dies war insofern nicht selbstverständlich, als dass zuvor durchaus eine sozialdemokratische Sympathie etwa mit der Pariser Kommune oder auch mit revolutionären Bewegungen gegen das russische Zarenregime bestand.
Den Liberalen war daran gelegen, die Willkür des Obrigkeitsstaates einzugrenzen, insofern auch sie sich davon bedroht fühlten. Dem Reichskanzler von Bismarck gelang es allerdings auch die Liberalen in einen nationalliberalen und demokratisch-liberalen Flügel zu spalten, wobei ersterer eine staatstragende Rolle einnahm und letzterer die Rolle eines demokratisches Korrektivs spielen durfte.
Bock beschreibt die anarchistische Bewegung – wahrscheinlich zutreffend – als einerseits zerrissen zwischen ihrer Abwendung und Ausgrenzung von der Sozialdemokratie und andererseits bedroht durch die staatliche Verfolgung – welche offenbar auch regelmässig auf das Mittel der Bespitzelung zurückgriff, um sozialrevolutionäre Kreise zu überwachen und zu zersetzen. Dies führte dazu, dass sie sich selbst abschotteten und utopische Vorstellungen als Glaubenssysteme pflegten, anstatt Teil einer wirklichen sozialen Bewegung zu bleiben.
Zwar wurden im Rahmen der Sozialisten 1300 Druckschriften und 332 Arbeiterorganisationen verboten, sowie 900 Personen ausgewiesen und 1500 mit Haftstrafen belegt. Dies verhinderte allerdings nicht die Aktivität der Radikalen, sowie die Formierung einer anarchistischen Strömung, wie sie sich insbesondere am Beispiel von Johann Most nachzeichnen lässt. Dieser gab in London die Zeitschrift „Freiheit“ heraus, welche illegal über ein Verteilernetzwerk nach Deutschland geschmuggelt und dort verbreitet wurde.
Der Rechtswissenschaftler zeigt auf, dass repressive Gesetzgebungen nicht immer für die Eindämmung von terroristischer Gewalt oder gar radikaler Einstellungen dienen, sondern unter Umständen sogar das Gegenteil bewirken können. Zudem wird aber auch deutlich, dass repressive Massnahmen gerade dazu dienen, Angst in der Bevölkerung zu schüren und die politische Opposition konform einzuhegen. Mit anderen Worten ist das Feindbild der „bombenlegenden Anarchisten“ weit mehr eine Konstruktion von Regierungspolitik, als dass es eine Realität abbilden würde.
In gewisser Hinsicht sind Regierungen in bestimmten Phasen auf die Konstruktion „innerer Feinde“ angewiesen. Dies führt zur ambivalenten Rolle sozialrevolutionärer Bestrebungen als strategischer Versuch der notwendigen Radikalisierung sozialer Bewegungen einerseits und ihrer Isolation und Karikaturierung andererseits.
Hans Diefenbacher (Hrsg.): Anarchismus. Zur Geschichte und Idee der herrschaftsfreien Gesellschaft. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1996. 229 Seiten. ca. SFr. 27.00. ISBN: 978-3534129959.


