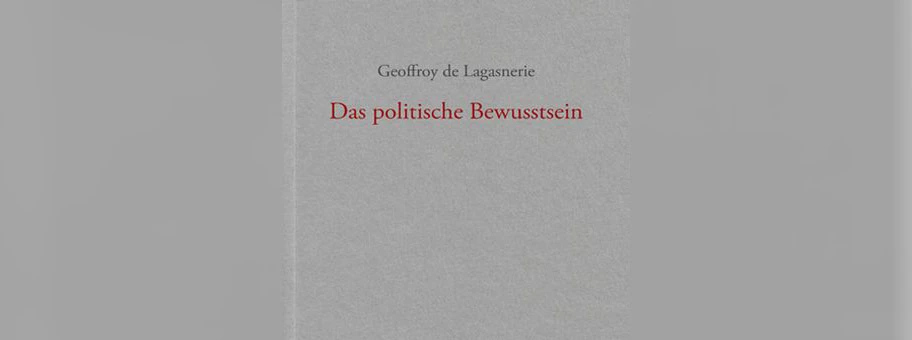Die Fiktionen politischer Begriffe entlarven
Zweifellos sind politisch-theoretische Diskurse von abstrakten Begrifflichkeiten geprägt. So etwas wie „Volk“, „Souveränität“, „Gemeinwille“ oder auch „Staat“ gibt es in der Realität nicht einfach. Derartige Entitäten werden durch politische Theorie konstruiert, um greifbar zu machen, was die politische Sphäre und ihre Logiken kennzeichnet. Doch bereits hier beginnt de Lagasnerie mit seiner Infragestellung.Er kritisiert die geläufige Vorstellung, dass Politik nach eigenen Gesetzmässigkeiten funktioniere, statt eine soziale Sphäre wie alle anderen zu sein. Trotz ihrer unterschiedlichen, teils diametral entgegengesetzten Positionen, so seine Argumentation, teilen alle politischen Akteur*innen die Vorstellungswelt fiktiver Begriffe und belügen sich selbst. Weder ein Gesellschaftsvertrag, noch die Unterwerfung durch die Kriegsführung eines Souveräns konstituiere aber politische Subjekte – wie etwa Hobbes behauptet –, weil wir den Staat als Zwangsgemeinschaft, seine Rechtssetzung und seinen Herrschaftsanspruch immer schon vorfinden, ohne uns ernsthaft von ihm lossagen zu können.
Ein (ultra-)realistisches, reduktionistisches Politikverständnis
Der Autor plädiert daher für eine Reduktion der Politik „auf das, was sie ist“ (S. 45) und meint damit, dass Souveränität stets angemasst ist und ihr nie im eigentlichen Sinne zugestimmt wurde. Politik bedeutet, bestimmte Rechtsvorstellungen gegen andere durchzusetzen und sie anderen aufzuzwingen – unabhängig davon, wie berechtigt oder sinnvoll die damit verbundenen Anliegen sein mögen und auch abseits dessen, ob die entsprechenden Verfahren als formal korrekt angesehen werden.Das Gesetz ist nicht rechtmässiger, weil es durch eine demokratische Prozedur eingerichtet wurde, sondern immer noch die Durchsetzung eines bestimmten Willens durch diejenigen, welche sich die Staatsmacht aneignen und sich ihrer bedienen können. Dementsprechend müssten unterworfene und ausgebeutete soziale Gruppen selbst in demokratischen Staaten als „innere Kolonie“ (S. 123ff.) bezeichnet werden. Aus dieser Position heraus zu kämpfen, führt demnach nicht zur Forderung nach Integration, sondern zur Distanzierung, zur dezisionistischen Selbstbestimmung marginalisierter Gruppen. Selbstverständlich sind Regierung, Staat und diesen häufig zugeordnete Politik nicht nur dies, sondern bestehen auch in Verhandlungen, Interessensausgleich oder gelegentlicher Umverteilung. De Lagasnerie fordert uns aber auf, Politik von Polizei, Gericht und Gefängnis aus zu denken.
Demokratie, Recht und Gewalt in die Augen blicken
Vor diesem Hintergrund dekonstruiert der Professor der politischen Philosophie und Soziologie die Kernvorstellungen seiner eigenen Profession. Demokratie etwa sei kein Wert für sich, da in ihr dennoch faktisch Wenige herrschen, Mehrheitsentscheide problematisch seien und es zudem keine überzeugende Definition für sie gäbe. Die Behauptung, eine Rechtsordnung schaffe unpersönliche Verfahren, abseits der Interessen, sozialen Positionen und kulturellen Prägungen seiner Träger*innen, erscheint in diesem Licht ebenso als ein Mythos. Darüber hinaus wird systematisch verschleiert, dass Staaten auf Gewalt gründen und diese kontinuierlich praktizieren, sei es in Form von Polizeirazzien oder Steuereintreibung. Statt diesen Grundlagen politischen Handelns ins Auge zu blicken, abstrahiere politische Theorie von ihnen und führe einen Diskurs über Legitimität. Dieser wirkt sich nach de Lagasnerie auf die (äusserst ungleich) Betroffenen von staatlicher Gewalt jedoch praktisch genauso aus, wie wenn die Gewalt von der Mafia oder Privatpersonen ausgehen würde. Diese Argumentation mündet schliesslich in eine Perspektivenumkehr:„Jedes Nachdenken über die Politik darf nicht mit einer Frage nach den Zielen und Zwecken von Institutionen, sondern muss mit der Suche nach ihren Mitteln beginnen. Die politische Grundfrage ist: Bis wohin? Wieweit bin ich bereit, Gewalt gegen eine anderen anzuwenden oder ihm meinen Willen aufzuzwingen?“ (S. 195)
Anstoss zu einer staatskritischen Sichtweise
Mit dieser grundsätzlich skeptischen Herangehensweise entwickelt de Lagasnerie einen innovativen Blickwinkel auf Politik, der nicht auf ihre Wiedergewinnung entgegen einer neoliberalen Technokratie oder ihre Ausweitung entgegen ihrer Stillstellung durch die rechte Gegenhegemonie abzielt. Dazu setzt er sich mit politischen Denker*innen wie Hobbes, Rousseau, Schmitt, Fanon, Foucault, Rawls, Bourdieu, Mouffe, Laclau, Agamben und Habermas auseinander.In Abgrenzung und Erweiterung von ihnen, sowie in der Wiederentdeckung des Soziologen Léon Duguit, der bereits 1901 den mythologischen Charakter eines personifizierten „Staatswillen“ herausstellt, gelangt der Autor zu seiner interessanten und unbequemen Sichtweise, die Wasser auf den Mühlen der Anarchist*innen ist. Dies bedeutet auch, über Konzepte des zivilen Ungehorsams hinaus zu gelangen, da mit diesem immer noch die politische Ordnung bestätigt werde. In den Worten de Lagasneries:
„Der Begriff des Ungehorsams gibt vor, auf starke Aktionen des Widerstands anwendbar zu sein, doch in Wirklichkeit verhindert er die Entfaltung einer radikalen Sprache. Zu sagen ‚Ich leiste dem Staat Ungehorsam', bedeutet, ihn nicht zu gefährden, denn es bedeutet zu sagen: ‚Ich gehöre ihm'. Es ist hingegen eine ganz andere Geschichte, ihm zu sagen: ‚Ich gehöre dir nicht, wir stehen im Konflikt miteinander'. Denn das führt zu ganz anderen Konsequenzen.“ (S. 131)
Trotz innovativer Anstösse überzeugt die Argumentation an einigen Stellen nicht ganz, wenn immer wieder betont wird, dass wir in eine vorfindliche Rechts-, Legitimitäts- und imaginäre Ordnung hineingeboren sind und sie uns nicht aussuchen können. Dies mag zwar stimmen, macht für die Wirksamkeit politischer Institutionen jedoch keinen Unterschied. Freilich stimmt es, dass das politische Denken in besonderem Masse von Fiktionen durchzogen ist und eine weitreichende Funktion zur ideologisch geprägten Sichtweise auf Herrschaftsordnungen darstellt.
Warum stattdessen aber der soziologische Blick per se auf die angenommene Wirklichkeit sozialer Beziehungen und Interaktionen reduzieren würde, also vom herrschaftlichen Denken frei wäre, bleibt unklar. Unter „Reduktion“ versteht de Lagasnerie dabei die Entmystifizierung der politischen Sphäre. Diese zu betreiben würde allerdings durchaus helfen, Herrschaft beim Namen zu nennen – und damit etwa auch Anhänger*innen radikaler Demokratietheorien vor manchen Fallstricken bewahren, welche in der affirmativen Anrufung der Politik liegen.