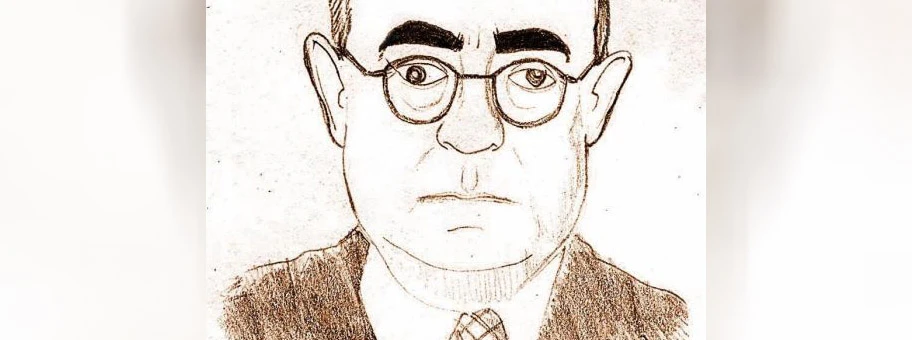Als zuletzt 2019 der Vortrag Adornos „Aspekte des neuen Rechtsradikalismus“ erschien, wurde dieser breit diskutiert. Der nun erschienene Band dagegen wurde vom Feuilleton ignoriert. Es kann als Bestätigung der bereits 1963 getätigten Anmerkung Adornos genommen werden, dass „ja doch die, wie man so sagt, philosophische Zeitstimmung keineswegs der Dialektik günstig ist“ (S. 9). Aktualität beweist der Band also gerade darin, dass er bis heute quer zur Zeitstimmung steht.
Kritik des methodischen Denkens
Die erste Vorlesung beginnt damit, was Dialektik nach der Frankfurter Schule sei:
„Sie ist der Versuch, gegen die Naivität des Intellekts, der glaubt, durch bloss formale Operationen der Wahrheit inne zu werden, wo er zugleich der Erfahrung der Sache bedarf, eben dieser Illusion nicht durch eigene Verfahren zu [verfallen], sondern durch die ausgeführte, durch die konkrete Kritik eben diese Illusion zu überwinden und zu einem angemesseneren, zu einem richtigeren und adäquateren Verfahren zu [gelangen]“ (S. 16).
Wenn sich das Denken dagegen einer Methode verdankt, bleibt die so Denkende bei sich und ihrer Logik und nicht der Logik der Sache. Anders gesagt: Wer methodisch denkt, dessen Urteile folgen nicht der Notwendigkeit des untersuchten Gegenstandes, sondern sind Ergebnis aus dem subjektiven Beschluss, die Sache nach der Seite der jeweiligen Methode sehen zu wollen. Das weiss Adorno:
„[…] ein Ausdruck wie ‚meine Philosophie' […] ist im Grunde anti-philosophisch; denn eine Philosophie hat in sich ja, ganz gleich, wie man selber dazu steht, den Anspruch der Verbindlichkeit und ist im Grunde darauf ausgerichtet, das ‚meine', das Individuum in seiner Zufälligkeit, das sie denkt, auszulöschen; und infolgedessen kann nichts törichter sein als der Narzissmus von Philosophen, die ihre Gedanken als ihre reklamieren, während, je mehr ein solcher Gedanke nur der eines Individuums ist, an das Individuum gebunden bleibt, um so weniger dieser Gedanke also taugt“ (S. 61).
Dialektik als Methode
Der oben zitierte Satz will die Negation jedoch nicht stehen lassen und zeigt einen Übergang des Philosophen an, nun selbst eine Methode zu entwickeln. Einmal den Fehler des methodischen Blickes erkannt, soll man ihn nicht etwa unterlassen, „sondern durch die ausgeführte, durch die konkrete Kritik eben diese Illusion […] überwinden und zu einem angemesseneren, zu einem richtigeren und adäquateren Verfahren [gelangen]“ (S. 16). Der kritische Theoretiker will also in seiner Vorlesung mit der Hinwendung zu den Gegenständen gar nicht nur diese erklären, sondern so zu einem „richtigeren und adäquateren Verfahren“ gelangen. Die Kritik der Methoden ist also nur sein Interludium für die kritische Methode.
Von Hegel hat Adorno dieses Anliegen nicht, wie er selbst schreibt. Bei dem alten Philosophen ist es nämlich so, dass „wenn ich mich rein der Sache überlasse, ich zugleich die dialektische Methode erfülle“ (S. 27). Das allerdings lässt Adorno nur zur Hälfte gelten. Er nimmt diese Bestimmung Hegels nicht als Abgesang an den Versuch, sich vor jeder Beschäftigung mit einem Gegenstand in den irren Zirkel zu begeben, wie die adäquate Betrachtung der Sache aussieht. Das nämlich, eine richtige Methode für den richtigen Gegenstand, setzt ja schon wieder Wissen über den Gegenstand voraus, das notwendig ganz ohne Methode gewonnen wurde: Sonst wäre ein Entsprechungsverhältnis aus Methode und Sache gar nicht zu behaupten. Noch einmal anders: Eine Methode des Denkens kann sich nur ausdenken, wer schon vor und ohne die Methode des Denkens fähig ist. Weil Adorno als Philosoph sich aber gerade dem Projekt einer Erkenntnismethode verschrieben hat, soll die Kritik der Methoden ausgerechnet eine kritische Methode ergeben:
„Das ist eines der besten Programme jedenfalls der Dialektik, dass nämlich der Inhalt, also das, womit die Philosophie es zu tun hat, nichts dadurch empfangen soll, dass man ihm irgendein ihm selbst fremdes Prinzip aufprägt, sondern die ganze Philosophie soll durch die dialektische Methode aus dem Inhalt herausgeholt werden“ (S. 75).
Mit diesem Widerspruch geht Adorno in seinen ganzen weiteren Vorlesungen schwanger: Einerseits soll man immer den Gegenstand – also beispielsweise das Denken – betrachten: „[…] dass der dialektische Blick nicht sich damit begnügen darf, irgendwelche dialektischen Strukturen von oben her dem Gegenstand der Erkenntnis aufzuerlegen“ (S. 76). Andererseits nimmt er Dialektik nicht – wie Hegel – als die Bewegungsform des Denkens und untersucht wie dieser in seiner Logik eben das Denken selbst: Was ist „Grund“, „Bedingung“, etc. Wenn Hegel ab und an in seinen Vorlesungen von der Methode der Dialektik spricht, dann beschreibt er nicht eine Denkschablone, die vor einer Beschäftigung mit einer Sache Berücksichtigung verlange. Hegel beschreibt damit eben den Gegenstand seiner Untersuchung: das Denken.
Auf sich selbst gerichtetes Denken
Dieser Fehler wird da sichtbar, wo Adorno vom Gegenstand absieht, mit dem Hegel sich beschäftigt. So referiert Adorno in der 6. Vorlesung über den technischen Fortschritt und inwiefern dieser in der kapitalistischen Ökonomie „die Widersprüche innerhalb der Gesellschaft anwachsen“ (S. 88) lasse, und sieht gerade darin sogar mehr als ein „bloss ausgedachtes Beispiel“ (S. 88), sondern eben „wie ein genuiner Begriff von Dialektik auszusehen hätte“ (ebenda.).
Hegel denkt aber in der Logik über das Denken nach. Insofern trifft auf die Logik auch die Identität von Methode und Gegenstand zu, die Adorno ganz prinzipiell behauptet:
„[…] weil man in dialektischem Denken zwischen Methode und Sache selbst gar nicht unterscheiden kann, so dass also die Darstellung als die eigentliche geronnene Methode der Philosophie deshalb immer auch ein Stück Sache selbst ist“ (S. 65).
Adorno nimmt hier das Besondere bei der Beschäftigung mit den Verkehrsformen des Denkens und verallgemeinert die Identität von Denken und Gegenstand über die einzige Sache hinaus, bei der diese Identität wirklich vorliegt: der Logik.
Noch einmal anders gesagt: Der Gegenstand der Logik von Hegel sind die Formen des Denkens, in denen der Verstand seine Gegenstände erfasst. Die Logik untersucht nicht, wie beispielsweise der technische Fortschritt im Kapitalismus gegen die Beschäftigten ausschlägt, sondern sie gibt Auskunft darüber, was ein „Grund“ ist, was eine „Kraft“, was „Besonderheit“ und so weiter. Nur hier, wo sich das Denken auf sich selbst richtet, gibt es die von Adorno behauptete Identität von Denken und Sache, eben weil beides dasselbe ist. Wo sich allerdings jemand ein Urteil über das Verhältnis von Produktivkraft und Produktionsmittel bildet, da kann man durchaus den logischen Vorgang der Urteilsbildung sehr gut unterscheiden von dem konkreten Urteil über den kapitalistischen Fortschritt.
Entsprechend dünn fällt der Erkenntnisgewinn beim Studium des dicken Bandes aus: Die jeweiligen Gegenstände – wie der technische Fortschritt – werden ja nicht für sich ernsthaft bestimmt, sondern dienen eben als Darstellung, wie ein „Begriff von Dialektik auszusehen hätte“. Anstatt sich also zu erklären, was zu erklären ist, wird darüber nachgedacht, wie man sich erklären könnte, was zu erklären wäre. Ein widersprüchliches Unterfangen.