Christian Leonhardt: Szenen des Politischen Politische Inszenierung
Sachliteratur
Inzwischen habe ich Christians Buch Szenen des Politischen. Radikale Demokratie und aktivistische Theorieproduktion durchgelesen und gratuliere noch mal, zur Veröffentlichung.
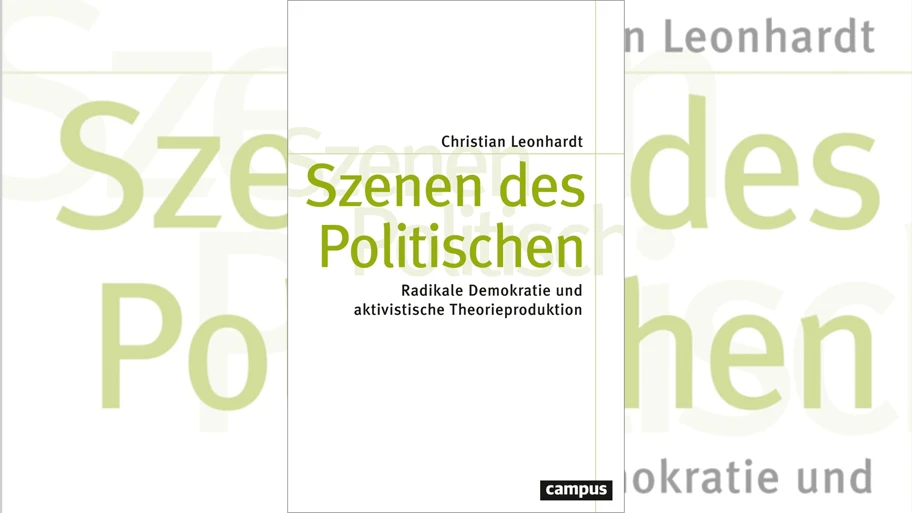
Mehr Artikel
Buchcover.
0
0
Eine ausführlichere Darstellung und Kommentierung folgt gegebenenfalls an anderer Stelle. Nur ganz knapp: Der Autor setzt sich mit der radikalen Demokratietheorie auseinander. Diese steht in einem Spannungsfeld zwischen einer liberalen und einer anarchistischen „Intuition“, wie Leonhardt es nennt. Ihm geht es darum, die liberale Auslegung zu kritisieren. Dazu arbeitet er sich insbesondere an Chantal Mouffe ab, welche Demokratie nur auf den Staat bezogen denkt, Hegemonie als nur-politische Auseinandersetzung im nationalstaatlichen Rahmen versteht und Pluralität auf die Fraktionskämpfe in einer Parteiendemokratie verkürzt.
Dagegen durchdenkt er die anarchistische Intuition dahinter insbesondere in der Auseinandersetzung mit Jacques Rancière. Dessen komplexer Begriff der Gleichheit bietet Anknüpfungspunkte, um den liberal-demokratischen Rahmen zu überschreiten und nach anderen Formen der Organisation und des Handelns zu fragen. Davon ausgehend untersucht der Autor insbesondere Occupy Wallstreet 2011 und bezieht das Denken von CrimethInc ein – was im Bereich der akademischen politischen Theorie äusserst selten vorkommt. Meiner Ansicht nach verstrickt er sich damit aber zugleich in das Problem, den „Aktivismus“, dessen „aktivistische Theorieproduktion“ er wertschätzt, erst (als Gegenbild des akademischen Bereichs) zu konstruieren. – Dazu aber wie gesagt eventuell ein andermal ausführlicher. Interessant für mich sind allerdings insbesondere Christian Überlegungen zum Politikbegriff. Aus anarchistischer (und auch radikal-demokratischer) Sicht, lässt sich nicht einfach so eine gegen-hegemoniale (autonome, oder wie er schreibt: „reine“) Politik formulieren. Doch auch der Umkehrschluss, es gäbe eine „reine“ anarchistische Anti-Politik, die nichts mit den gegebenen Herrschaftsverhältnissen und ihren Institutionen zu tun hätte und gleichwohl die Gesellschaft verändern könnte, wäre ein Trugschluss. Meiner Ansicht nach lässt sich diese Paradoxie nicht auflösen, was das anarchistische Denken gerade so spannend macht. – Doch auch diese Diskussion könnten wir an anderer Stelle führen, wenn sich die Gelegenheit dafür bieten würde. Es folgt ein knapper Auszug, um einen Eindruck des Buches zu vermitteln:
Wie lässt sich Pluralität und Relation radikaldemokratisch jenseits der liberalen Intuition denken? Und kann Theorie radikaldemokratisch produziert werden, anstatt in der Theorie nur über radikale Demokratie zu sprechen? Diesen Fragen gehe ich im Folgenden nach und wenig überraschend argumentiere ich dafür, dass es sich zur Beantwortung lohnt, einer anarchistischen Intuition zu folgen. Das heisst, grundsätzlich nicht mit einem Trennenden, sondern einem relationalen Politikverständnis anzusetzen, in dem die Subjekte der Theorie nicht zum Verschwinden gebracht werden und Freiheit und Gleichheit erst aus und in Beziehungen selbst entstehen. Hierbei sind drei Dinge wichtig: Erstens dürfte es auf der Hand liegen, dass eine anarchistische Intuition ein Politikverständnis jenseits des Staates verfolgt, um dieser Form von Hierarchisierungen von Beziehungen zu entgehen (es gibt natürlich auch andere).
Allerdings bedeutet dies weder, dass Politiken jenseits des Staates auf Organisierung und Institutionalisierung verzichten könnte noch sie sich nicht mehr mit staatlichen Institutionen auseinandersetzen müssten. Ein radikaldemokratisches Handeln, das einer anarchistischen Intuition folgt, befindet sich immer noch in einer durch hegemoniale Projekte geprägten Gesellschaft. Es gibt daher keine »reine« Politik jenseits der Hegemonie, sondern ein solches Handeln steht immer wieder in Auseinandersetzung mit hegemonialen und gegenhegemonialen Akteur*innen und Prozessen, mit sich selbst und seinem eigenen (Gegen-)Hegemonial-Werden.
Daher macht es zweitens Sinn, sich die Situationen und Orte anzusehen, die Relationen und die Artikulationen von Vielheit in ihnen, in denen Theoretiker*innen radikaler Demokratie Momente eben dieser zu erblicken meinten. Das meine ich mit der Auseinandersetzung mit aktivistischer Theorieproduktion, also Theorieproduktionen aus sozialen Bewegungen. Nicht als etwas, was von der Wissenschaft untersucht werden müsste, um zu erklären, was (eigentlich) damit gemeint ist, was die Aktivist*innen (eigentlich) wollen, sondern um in der Auseinandersetzung mit akademischer und aktivistischer Theorie, der Auslotung ihrer theoretischen Affinitäten, Überlegungen zu einer lokal-situativen Theorie radikaldemokratischen Handelns und Umgänge mit Vielheit anzustellen.
Drittens und letztens bedeutet einer anarchistischen Intuition zu folgen, der egalitären Relationalität insofern Rechnung tragen zu wollen, Texte unabhängig von ihren Verfasser*innen und Produktionsorten miteinander in Beziehung treten zu lassen, ohne dabei ihre Situiertheit zu vergessen. Eine Möglichkeit das zu tun, ist, alle Texte als Erzählungen zu begreifen. So verstehe ich Politische Theorien – wie ich weiter unten genauer ausführe und egal ob aktivistisch oder akademisch – als narrative Versuche, auf einer abstrakten Ebene Gesellschaft, Subjekte und Handeln abzubilden und diese narrativen Versuche haben immer auch eine affektive Dimension.
Jede Theorie, jede These und jedes Argument will überzeugen und Überzeugung, gerade politische – und wer müsste da nicht mehr zustimmen als Mouffe –, setzt immer auch auf der affektiven Ebene an. Das abstrakteste und logistische Argument spricht gerade durch seine abstrakt-logische Form an – oder eben nicht – und seit dem Beginn der westlichen Philosophie mit Platon und Aristoteles gibt es die Auseinandersetzung mit und die Abgrenzung zum Literarischen, die nie so recht gelingt. Schon Platon konstruiert um seine Philosophie Erzählungen (zum Beispiel die vom Höhlengleichnis) und Rawls' »original position« ist mitunter eine ziemlich überzeugende Geschichte. Ganz abgesehen von den vielen literarischen Verweisen, die sich in der Politischen Theorie – und erst recht in diesem Buch – tummeln. Aber diese »Geschichten« sind nicht nur Erklärungsbeiwerk, sondern wesentlicher Bestandteil des Arguments oder um es mit Laclau und Mouffe zu sagen:
»[…] Synonyme, Metonymie und Metaphern sind keine Gedankenformen, die einer ursprünglichen, konstitutiven Buchstäblichkeit sozialer Verhältnisse einen zweiten Sinn hinzufügen; vielmehr sind sie selbst Teil des ursprünglichen Terrains, auf dem das Soziale konstituiert wird.« (Laclau/Mouffe 2012: 147)
In diesen Geschichten, Anspielungen und Metaphern »inszeniert« sich politische Theorie und im Falle der radikalen Demokratietheorie geschieht dies nicht selten mit Bezug zu sozialen Bewegungen und deren Reflexionen. Solchen Reflexionen gehe ich am Beispiel Occupy Wall Street am Ende dieses Teils und im dritten Teil des Buches in Bezug auf widerständigen Artikulationen von Vielheit nach. (Leonhardt 2024: 149f.)
Christian Leonhardt: Szenen des Politischen. Radikale Demokratie und aktivistische Theorieproduktion. Campus 2024. 311 Seiten, ca. 67.00 SFr. ISBN: 978-3-593-51975-3.


