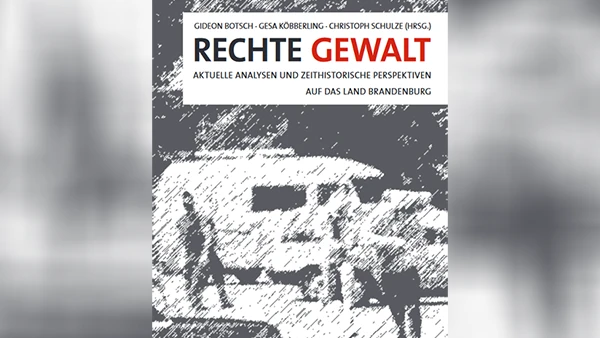Wenn das geborstene Fenster, von dem man die zermarterte Strandkante sehen konnte, nicht so gescheppert hätte, wäre vielleicht die Brise zu hören gewesen, die einen dunklen Strich über die aufgewühlte Tiefe zog.

Mehr Artikel
Gezeiten. Foto: Mario Sixtus (CC BY-NC-SA 2.0 cropped)
1. September 2020
0
0
28 min.
Drucken
Korrektur
Weiter draussen sah man hier und dort einige Dachziegel oder ein Stück Dachpappe über dem Wasser. Ein Schornstein, vielleicht von einer ehemaligen Räucherei, schlotterte auf den Wellen. Die Insel war wie eine Sandbank, ein Riff, das auf die falsche Seite der Meeresoberfläche geraten war. Alles was hinfällig aus dem Wasser ragte, bereitete sich in Todesangst auf den nächsten Sturm vor.
Da er die Angelegenheit nicht zum ersten Mal erörterte, liess er sich schwer auf den Stuhl am Tischende nieder. Gleich würden sie zur Sitzung erscheinen. Sollte eigentlich einfach und längst erledigt sein. Alles war vorhanden: Unterschriften, Papiere, Pläne. Sogar ermutigende Worte des Präsidenten. Aber sie weigerten sich, wollten nicht hören. Sie weigerten sich, von einigen aus dem Zusammenhang gerissenen Worten einer altertümlichen Schrift abzulassen. Und lag es nicht an ihr?
War sie es nicht, die ihnen den Verstand aussog? Die sie mit schrill krächzender Stimme einschüchterte? Die mit fuchtelnder Bibel und wild rollenden Augen Zwang ausübte, sogar auf einige der Jugendlichen, die es hin und wieder wagten, nicht zum Gottesdienst zu erscheinen? Sie hatten Angst vor der Hexe. Sie mieden sie und gingen Umwege auf den Dorfstrassen.
Der Bürgermeister legte beide Hände an die Stirn, schloss die Augen und rieb sich mit gespreizten Fingern unsanft den Haaransatz. Nun bekam man wohl die Umstände, die man verdient hatte.
Das Dorf war in zwei Teile gespalten. Zum Meer hin eine menschenleere Ansammlung von Schuppen und Fischerbuden. Stege, die nirgendwohin führten, einige bereits unter Wasser. Und die Baracken weiter draussen waren zur Hälfte ertrunken. Wie weggeworfen, ohne Sinn, ohne Plan. Dann das Dorf selbst, oder was davon übrig war. Von den zusammenbrechenden Schuppen war es durch einen breiten Wassergraben getrennt. Ein einziger der verlassenen Stege führte noch fast bis zum abgenagten Strand und endete vor einem höhlenähnlichen Loch, das das Meer gegraben und geschluckt hatte.
Die wenigen neuen Stege, die höher auf dem Land eingepfählt worden waren, wurden bereits bedroht. Badeleitern, die Kinder früher benutzt hatten, wurden nicht mehr gebraucht. Nun konnte man geradewegs ins Wasser gleiten. Das Mädchen, das die Stufen gezählt hatte, als sie klein war, konnte sie nicht mehr sehen, nicht einmal die oberste.
Auf der anderen Seite der Insel der Betonpier mit einer Reihe von Laternenpfählen. Immer häufiger lag der Pier unter Wasser, und die Laternen versuchten verloren und verwirrt, zum Himmel emporzuragen.
Der Hafen! Eine immer brüchigere Nabelschnur zum Festland. Maschinen zur Befestigung von Stein und Beton balancierten wie kleine Boote hin und zurück. Ein ständiger, ungleicher Kampf.
Der Bürgermeister schob den Evakuierungsplan beiseite und legte die Hand schwer auf den Rest des Papierstapels: Anweisungen, Karten, Sammelplätze, weitere Treffpunkte, Zeitpläne. Er hatte unzählige Gespräche mit dem Gouverneur und letztens auch mit dem Präsidenten geführt. Aber man war ja in Gottes Händen.
Er griff nach dem Wasserglas, führte es langsam zum Mund. Um den Tisch herum wurde mit den Stühlen gerückt. Man prasselte mit Papieren und deutete auf Tabellen.
»Was bereits bewilligte und weitere Mittel betrifft, die zur Verfügung stehen, um einen Deich um unsere Insel anzulegen, so besteht unsere Aufgabe darin, dazu Stellung zu nehmen, inwieweit wir Zuschüsse oder Hilfe vom Festland beantragen müssen. Wir wissen alle, dass Stürme und Fluten in nicht allzu ferner Zukunft drohen, noch mehr von unseren Häusern wegzuspülen. Wir wissen auch, dass wir, wenn wir den Deich nicht bauen, gezwungen sein werden, die Insel zu evakuieren und unsere Häuser zu verlassen – wie das für viele von uns bereits der Fall war. Daher ist es von …«
»Lüge!«
Einige der Blätter, die der Bürgermeister in der Hand gehalten hatte, glitten rasch über die Tischplatte.
»Niemand braucht sein Haus zu verlassen! Niemand!«
Die ältere Dame hatte sich erhoben. In der knochigen Rechten hielt sie ein dickes schwarzes Buch, mit dem sie wild herumfuchtelte. Von dessen ungewöhnlichen und starken Messingbeschlägen blitzte es durch die Luft.
»Niemand braucht sein Haus zu verlassen, solange uns der Herr beisteht. Sie zweifeln doch wohl nicht am Wort des Herrn?«
Sie senkte ihre Bibel und stierte offenen Mundes in den Raum. Es zuckte in ihrem sehnigen Hals. Einige murmelten nickend miteinander, andere wanden sich auf ihren Stühlen.
Der Bürgermeister, der täppisch seine flatternden Blätter zusammengerafft hatte, wollte gerade wieder das Wort ergreifen, als sich ein kräftiger Mann mit wettergegerbtem Gesicht so schnell erhob, dass der Stuhl hinter ihm kippte und mit einem Echo wie von einem Gewehrschuss zu Boden fiel.
»Dummheiten! Dummheiten! Wir haben viele Boote verloren, weil der Hafen nicht viel Schutz bietet. Die Jungen hören mit dem Fischfang auf und ziehen an Land, um Besseres zu finden. Jedes Jahr werden wir weniger. Das wissen alle. Jeder hier weiss das. Wenn wir den Deich nicht bauen, keine Zuschüsse von der Regierung wollen – ja, dann wird unsere Insel wie Atlantis vom Meer verschluckt. Sie wissen das, Sie alle hier an diesem Tisch. Sie wissen es nur allzu gut!«
Einige schauten stumm auf ihre Hände. Andere, die sich am Eingang ein Gesangbuch gegriffen hatten, hielten es jetzt vor sich wie eine Art Schild.
Der grobe Mann riss eins der schwarzen Bücher an sich und schleuderte es kraftvoll an die Wand. Die flatternden Blätter kamen erst zur Ruhe, als sie wie eine erschossene Möwe auf den Boden gesegelt waren.
»Warum dem Herrn nicht helfen? Warum, meine Freunde, sollen wir unserem Herrn nicht helfen, die Insel zu bewahren, die er, wie Sie sagen, einst geschaffen hat? Ihm helfen, den Deich zu bauen! Er scheint es von sich aus nicht zustande zu bringen.«
Diejenigen, die sich hinter den schwarzen Büchern verborgen hatten, legten sie eilig auf den Tisch und hielten die Hände schützend über sie.
»Alles andere wäre ja widersinnig! Ein Willkürakt gegen jeglichen Verstand! Eine Schande gegenüber …«
Eine schrille Stimme brach aus dem Gemurmel der Leute und dem Schürfen der Stühle hervor: »Ja, wir bezahlen Steuer! Oder etwa nicht? Also haben wir ein Recht darauf, dass unsere Häuser beschützt werden. Wie viele sollen denn noch in diesem verdammten Wasser ersaufen? Wie viele von uns müssen von hier vertrieben werden, ehe man etwas unternimmt?«
Die ältere Dame, die sich die ganze Zeit aufrecht hielt und unermüdlich an der Langseite des Tischs hin und her ging, streckte sich noch mehr. Sie drohte mit der Faust, und ihre Stimme war laut und krächzte schneidend: »So sprechen die Verleiteten! Die im Geist verwirrt und von dem Anderen, dem Dunklen, verführt sind. Von dem, der mit seinen Stürmen und Gezeiten bösartig an unserer Insel frisst, um uns einzuschüchtern, damit wir unsere Strände aufgeben, an denen wir seit undenklichen Zeiten gewandelt sind. Es sind unsere Strände! Wenn wir auf solches Gerede hören, wird sich der Herr von uns abwenden. Der Herr schaut nicht nach denen, die zweifeln. Der Herr kümmert sich um diejenigen, die glauben. Haltet euch daran! Hört auf mich!«
Nun schwang sie die Bibel hoch in die Luft.
Ein Mann mittleren Alters, mit üppigem Bart und dunkel funkelnden Augen stand auf und schlug sein Gesangbuch auf den Tisch: »Die Ingenieure vom Festland können so viele Deiche und Dämme bauen, wie sie wollen. Es wird nicht helfen. Das hier ist eine Strafe. Gottes Strafe für unser miserables Leben. Dafür, dass wir seinen Willen und seine Gebote nicht befolgen, dass wir seine Schöpfung missachten.«
Die ältere Dame fuchtelte abermals mit der Bibel: »Der Herr würde in Zorn entbrennen, falls wir diesen Deich bauten. Als hätten wir kein Vertrauen, keinen Glauben. Wenn wir, seine eigenen Kinder, ihm zuwiderhandeln, sind wir Verworfene.«
»Ja, ja …«
Gemurmel und Nicken füllte den Saal.
Das Mädchen geht den Strand entlang. Der Sand scheuert zwischen ihren Zehen. Auf dieser Seite der Insel ist sie schon lange nicht gewesen. Kaum, dass sie etwas wiedererkennt.
Sie tritt auf etwas Hartes. Sie beugt sich nieder und hebt ein Stück von einem Ziegel auf. Dann sieht sie, dass noch mehr im Sand stecken. Und immer mehr. Hat hier ein Haus gestanden? Wer hatte hier gewohnt? Dann tritt sie wieder auf etwas, und es schneidet ihr in den Fuss. Ein Teller. Und als sie mit den Fingern gräbt, findet sie weitere Scherben. Die Reste einer Tasse. Wie gross war die Insel eigentlich einmal gewesen? Sie blickt auf das Meer hinaus. Unter den hungrigen Wogen – was gab es da noch alles?
Ein grauer Regen begann, an die hohen Scheiben zu trommeln, als der Fischer den Saal verliess.
»Das ist ja einfach widersinnig! So verdammt widersinnig!« Die Fenster scheppern noch mehr, als die Tür zugeschlagen
wurde. Tumult brach aus. Die Leute erhoben sich von ihren Stühlen, redeten durcheinander, wedelten mit den Gesangbüchern, unterbrachen einander und stiessen zusammen.
Der Bürgermeister klopfte auf den Tisch: »Hier in meinen Händen habe ich Berechnungen, Skizzen, ja, alles, was zum Baubeginn benötigt wird. Ich habe Garantien dafür, dass wir, die wir hier leben, auch weiterhin hier wohnen können. Ich …«
Er klopfte laut mit dem Hämmerchen. Und noch lauter, bis es ruhig wurde.
»Jetzt schreiten wir zur Abstimmung.«
Es wurden Briefumschläge ausgeteilt. Eine lange Stille, in der man nur das Kratzen der Schreibfedern hörte.
Kurz darauf kniete die ältere Dame nieder: »Danke, lieber Gott. Danke, Herr, für unser aller Vertrauen auf dich.«
Am selben Abend verliessen einige Fischerboote den Hafen.
Ausserdem eine Reihe kleinerer Boote.
Der Dorfpfarrer, der während der gesamten Sitzung geschwiegen hatte, blätterte noch spät in der Nacht in seiner Bibel. Wie im Fieber suchte er nach den Worten. Und obwohl er so eifrig blätterte und etliche Kapitel Wort für Wort las, fand er sie nicht.
Einige graue, löchrige Bretter sind mit Hanffetzen, Nylonfäden und flatternden Plastiktüten zu einem Gewirr verheddert. Dazwischen ein toter Vogel mit einem Angelhaken, der sich im Schnabel verkeilt hat. Ein Schwarm kleiner Fliegen wimmelt über vertrockneten Quallen. Ein Geruch von Verwesung und Tod dringt zwischen den Steinen hervor, die, grosse wie kleine, eine Strandlinie bilden: ein erbärmlicher Schutz gegen die Wellen, die sie unaufhörlich nach oben und aufs Land stossen.
Das Mädchen stochert im Sand. Dann steht sie auf und sieht etwas Weisses, das ein Stück weit entfernt schimmert. Sie läuft hin und findet eine Gestalt, die auf dem Bauch liegt. Eine einsame Krabbe kriecht an deren einer Schulter entlang. Tang, grüne Klumpen aus Algen schmieren den nackten Rücken hinunter. Eine magere und ganz kleine Gestalt: ein gestürzter Engel! Vollkommen unbeweglich, der eine Flügel abgebrochen, das Gesicht in den Sand gegraben.
Sie rennt zum Dorf. Als sie die Abkürzung über den Friedhof nimmt, stösst sie auf einige Menschen: »Ein Engel! Ein Engel! Am Strand liegt ein Engel!«
Ein Herr mit altmodischem Hut schiebt sie beiseite: »Blödsinn! Verschwinde! Der Friedhof ist kein Spielplatz. Mach dich davon!«
Das Mädchen drängelt sich an einigen älteren Damen vorbei und sieht vor der Friedhofsmauer eine jüngere Frau mit einem Kind an der Hand. Sie ergreift ihren Arm und zieht so heftig daran, dass die Frau schwankt. Das kleine Kind beginnt zu weinen.
»Am Strand liegt ein Engel. Und er hat nur einen Flügel!« »Aber liebes Kind, ein Engel! Dir ist doch wohl klar …« »Ich habe ihn gesehen. Mit eigenen Augen! Bitte. Es ist ein Engel. Ein richtiger Engel. Ein Engel am Strand. Wir müssen ihn holen! Bitte, bitte!«
Als der Bürgermeister einige Zeit später das Gespräch vom Festland entgegennahm, war es zu spät. Zu spät für die Hilfe, die man nicht haben wollte.
Das Wasser reichte bereits bis zur Kirchtreppe hinauf. Ein muffiger Geruch nach vermodertem Tang und Seegras lag schwer über dem Dorf. Und wenn es windig und das Meer wild war, plätscherten schon kleine Wellen in der Sakristei.
An jenem Morgen klingelte das Telefon. Und am selben Morgen entdeckte der Küster, dass einige Gesangbücher, die in der Sakristei auf dem untersten Regal standen, miteinander verklebt waren.
Der Bürgermeister verzog das Gesicht vor dem Telefon. Die Nummer im Display kannte er, jedenfalls einige Ziffern davon.
»Wir verfolgen mit Interesse und Anteilnahme, was auf Ihrer Insel geschieht. Und wir sind auch sicher, dass falsche Klimapropheten und Schwarzseher zu laut geschrien haben. Gott wird Ihnen helfen – und ich auch. Ich verspreche Ihnen, persönlich dafür zu sorgen, dass Sie auch weiterhin auf Ihrer Insel leben können.«
»Danke, Herr Präsident. Wir verlassen uns auf Sie. Und wir vertrauen auf Gott.«
Im selben Augenblick, als der Bürgermeister das Telefon einsteckte, verliessen einige der letzten Fischerboote die Insel. In der Dämmerung konnte man Gruppen grauer Schattenfiguren sehen, die auf den Decks umhergingen.
Sie begaben sich zum Strand, einige Leute, und das Mädchen lief voraus. Sie winkte eifrig mit den Armen. Als sie hinkamen, blieben sie verblüfft stehen. Da lag der Engel. Hätte nicht der Flügel aus dem Tang hervorgeragt, wäre man wohl vorbeigegangen, ohne etwas Besonderes zu bemerken. Gleich daneben schimmerte der abgebrochene Flügel im Sand. Er glänzte, wenn die kleinen Wellen das letzte Sonnenlicht in Tausende blitzender Strahlen brachen.
Vorsichtig hob man die Gestalt mit den gestutzten Flügeln auf. Sie war so zierlich und unscheinbar, dass das Mädchen sie wohl allein nach Haus ins Dorf hätte tragen können. Nun beugte sie sich stattdessen hinunter und ergriff den abgelösten, zerbrochenen Flügel und drückte ihn an ihre Brust.
Da sie keine Tragbahre mit sich hatten, mussten sie das zarte Wesen zwischen sich nehmen. Hin und wieder schleifte dabei der eine Flügel im Sand und zeichnete eine Spur in der Sonne. Eine merkwürdige Spur: wie aus Feuer.
Die kleine Prozession ging zur Kirche. Man legte den Engel vorsichtig vor der Kirchentür ab. Die Glocken wurden geläutet. Die Dorfbewohner kamen zusammen und knieten im Abend nieder.
Als das Wasser die Schwelle der kleinen Dorfkirche erreichte, sah man ein, dass nichts zu machen war. Die Gemeinde war machtlos. Der Engel neben der Kirchentreppe war kaum noch zu sehen. Die einsame Flügelspitze ragte aus dem Wasser empor.
Der Pfarrer kniete nieder: »Lasset uns beten!«
Es war Sonntag, und die Wogen hatten sich bis über den Fussboden der Kirche vorgefressen. Der Pfarrer hatte gerade seine Brille abgenommen und das Buch vor sich hingelegt.
»Der Dunkle versucht, mit seinen schwarzen, heimtückischen Kniffen Unglück über unsere Insel zu bringen. Mit seinen bösartigen Händen will er dafür sorgen, dass der Zorn des Meeres unsere Heimstatt auf Erden tilgt. Aber ich sage euch, ihr selbst habt das Zeichen gesehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Zeichen ist. Ihr habt selbst die merkwürdige und geflügelte Gestalt gesehen, die vom Himmel gefallen ist. Und heute habe ich mit dem Herrn gesprochen. Er gebietet uns – gelobt sei der Herr –, Zuversicht zu haben. Unsere Insel wird wie Eden blühen und leben, solange wir ihn anbeten. Dies ist das Gelöbnis, dass uns der Herr in seiner Gnade gegeben hat. Lasset uns niederknien und danksagen.«
Ein einmütiges Amen, laut und widerhallend. Aber in das Echo mischte sich das Weinen einiger kleiner Kinder. Das schmutzige Wasser plätscherte eiskalt über ihre Schuhe und Knöchel.
»Hier folgen die neuesten Angaben über Stärke und Richtung. Warnung vor Orkanwinden! Es ist … einen Augenblick … ja, es ist zu erwarten, dass der Wasserstand um bis zu drei Meter steigt. Ich wiederhole: drei Meter! Sie müssen evakuieren. Ich wiederhole: drei Meter!«
Die Stimme schrillte immer wieder aus Telefon und Fernseher. Die Mitteilung wurde mit lähmender Deutlichkeit mehrfach wiederholt.
Gegen den dunkler werdenden Himmel verlässt der Bürgermeister mit einer Gruppe von Menschen die Insel. Sie schleppen Koffer, Rucksäcke, schieben Karren, Fahrräder, Kinderwagen und einige Ältere in Rollstühlen. Ein paar Jugendliche tragen eine Bahre.
Schwer bepackt schleppt der Zug schlängelnd an seiner Last und wankt Richtung Hafen und Betonpier. Einige machen sich in eigenen, überfüllten Booten davon. Andere warten auf dem Pier. Sie warten auf Rettung. Der Horizont verdunkelt sich. Erste Windböen wirbeln das Wasser auf.
Im Gedränge wird eine ältere Frau über die Kante gestossen und fällt schreiend ins Wasser. Für einen Augenblick verschwindet sie unter der Oberfläche. Der Koffer, den sie bei sich hatte, hat sich im Fall geöffnet, und ihr Hab und Gut schwimmt auf den Wellen. Schon taucht sie mit weit aufgesperrten Augen hustend und keuchend auf. Jemand wirft ihr einen alten, zerschlissenen Rettungsring zu. Die Frau greift danach mit wild fechtenden Armen. Ihre heiseren, röchelnden Schreie übertönen den Lärm von Bootmotoren und das Knattern eines Hubschraubers.
»Ich ertrinke! Hilfe! Kann denn niemand helfen?« »Halten Sie sich fest!«
Sie ziehen sie auf den Pier. Sie zittert und ringt heiser um Atem.
Ein Junge reisst sich von seiner Mutter los, die ihn an der Hand gehalten hatte. Er zeigt auf die nasse Erscheinung.
»Aber, Mama, ist das nicht die Tante? Die immer vom Herrn spricht? Die so viel von Gott redet?«
Die Mutter bringt den Jungen zum Schweigen und zieht ihn rasch zur Seite und in die Reihe.
Jemand hüllt eine Decke um die fröstelnde Alte. Eine schmutzgraue Decke, die gegen die aschgrauen Wangen dennoch fast weiss leuchtet. Die schwarze Bibel mit den groben Messingbeschlägen, die aus ihrem Koffer gefallen ist, sinkt langsam und verschwindet ins Dunkle unter der Wasseroberfläche. Der Schein der glänzenden Eckbeschläge verglimmt.
Nach wie vor ist der Pfarrer mit einer treuen Schar in der Kirche. Er antwortet auf ein Telefonsignal und stellt der Lautsprecher an. Die Stimme hallt durch das Kirchenschiff und kann von allen gehört werden.
»Die Evakuierung scheint gut zu laufen. Wir warten jetzt auf Ihre Gruppe. Sie müssen unmittelbar die Kirche verlassen und sich zum Pier hinunterbegeben.«
Der Pfarrer sieht in die Gesichter der Menschen, die sich um ihn versammelt haben. Er hält sich das Telefon ans Ohr.
»Wir sind sicher in den Händen des Herrn.«
»Der Wind hat bereits zugenommen. Demnächst wird es schwierig für unsere Boote, in den Hafen zu gelangen. Sie müssen die Kirche unmittelbar verlassen!«
Der Pfarrer betrachtet abermals die Versammelten. Es ist still – bis auf das zunehmende Rauschen, das durch Wände und Fenster zu dringen beginnt.
»Wir vertrauen auf den Herrn.«
Die Verbindung wird unterbrochen. Der Pfarrer sinkt auf die Knie und betet. Die anderen folgen seinem Beispiel.
»Papa, Papa! Wir müssen von der Insel. Weg von hier! Papa!« Sie wirft sich ihrem Vater zu Füssen. Draussen verlassen die letzten Rettungsboote die Insel über das dunkle Wasser. Sie zieht und rückt an den Hosenbeinen des Vaters.
»Papa, Papa!«
»Schweig, Mädchen! Schweig! Alles hat seinen Sinn, hörst du? Alles liegt in den Händen des Herrn.«
Sie senkt den Kopf in den Sand, der von salzigem Schaum schon weiss gefärbt ist.
Sie besitzen einen flachen Kahn, den sie auf einen Hügel über dem Haus gezogen haben.
»Papa, Papa! Wir nehmen das Boot. Wir können uns retten, Papa. Wir rudern hinaus. Wir schaffen es, Papa. Mama … hol Mama … komm!«
Der Vater steht vor ihr im Sturm, wankend und beinah das Gleichgewicht verlierend.
»Der Kahn – bei diesem Wetter! Als wüsstest du's nicht besser!«
Er nimmt sie am Arm und schiebt sie zum Haus. Der weisse Schaum wird in grossen Flocken in den Wind getrieben und bleibt an der Hauswand kleben.
»Papa, ich will nicht hinein! Lass mich los!«
Sie befreit sich vom Griff des Vaters.
»Jetzt kommst du her! Sonst verflucht dich der Herr auf ewige Zeiten!«
Sie stolpert rückwärts, als der Vater ungeschickt nach ihr tappt. Sein Gesicht ist verzerrt und seine Stimme so unheimlich, wie sie sie noch nie gehört hat.
»Der Herr wird dich verfluchen! Du bist verdammt. Wer sich vom Herrn abwendet, wird beim Jüngsten Gericht in der Hölle schmachten. So steht es geschrieben. Hörst du, was ich sage? So steht es geschrieben!«
Der Vater schreit in den pfeifenden Wind, aber sie stolpert weiter rückwärts über den Sand. Sie sieht zum Hügel und zum Kahn hinüber. Aus den Augen dringen Tränen, die sie nicht aufhalten kann.
Die läuft davon. Rennt so rasch, wie sie kann. Schluchzend, heulend. Es bleibt ihr in der Kehle stecken, und sie ringt nach Atem. Sie muss weg von Vaters Geschrei. Dicht hinter ihr seine brüllende Stimme und das Wimmern der Mutter, die aus dem Haus gestürzt kommt.
Als der Vater eins der Nachbarhäuser weiter unten am Hang sieht, bemerkt er, wie das peitschende Wasser nach dem Dach zu greifen beginnt. Und als die ersten Ziegel in den wirbelnden Wellen verschwinden, geht er in sein Haus zurück.
Der Kahn plätschert auf den Pfützen, die immer weiter den Hügel hinaufdringen. Er schaukelt hin und her, bleibt aber liegen. Der abgebrochene Engelflügel schwappt auf dem Leckwasser, das sich auf dem Boden des Kahns gebildet hat. Sie hatte den Flügel dorthin getragen, als gesagt wurde, dass man die Insel verlassen würde. Er musste gerettet werden!
Sie kann das Haus nicht mehr sehen, bis sie in den Kahn steigt und eine Welle, die höher als alle anderen ist, sie emporhebt. Durch das Fenster, das vom Wasser eingedrückt ist, ahnt sie die knienden Gestalten, bis das Licht ausgeht.
Eine Welle wirft den Kahn gewaltig auf den Sand. Das Mädchen wird gegen eine Ruderbank am Bug geschleudert und sinkt in die Tiefe der Dunkelheit.
Erst als das Morgenlicht beginnt, das Dunkel in ihrem Kopf zu vertreiben, entdeckt sie mit aufgesperrten Augen etwas blendend Weisses. Das Leckwasser auf dem Boden des Kahns spiegelt sich und glitzert im gebrochenen Engelflügel. Noch dröhnt es im Kopf, als sie sich in der Sonne und im dumpfen Grollen der langen Dünung aufrichtet. Der Wind ist abgeflaut, und als sie mit geschwollenen Augen umherblinzelt und überall die verstreuten Trümmer sieht, wird ihr klar, dass sie allein ist. So einsam wie der verlorene Flügel, den sie im schmutzigen Wasser auf dem Boden des Kahns liegen gelassen hat.
Sie kriecht über die Reling und setzt einen Fuss in den Sand. Die Beine zittern und geben nach. Sie ist hungrig und muss losgehen, um zu suchen. Irgendetwas verbirgt sich bestimmt irgendwo. Sie schaut zur Kirche hinüber, die schräg über einem jähen Abgrund hängt, den die verschlungene Strandkante gebildet hat. Gebrechlich, als hätte ein Seemonster seine gewaltigen Zähne in die Kirche geschlagen und ein grosses Stück davon abgebissen. Das Mädchen sieht einige verlassene Häuser, die noch stehen. Vielleicht kann sie da irgendwie hineinkommen und etwas zu essen finden.
Im letzten Haus, das sich stark über den Abgrund neigt, entdeckt sie einen Brotlaib und reisst ein Stück von der Kante ab. Es schmeckt salzig und muffig, aber sie drückt das feuchte Brot an die Brust und kehrt um.
Als sie sich dem Fuss des Hügels nähert, sieht sie, dass die weitgestreckten Dünen mit dem dichten Schilf verschwunden sind, die unterhalb ihrer kleinen Bucht ausgebreitet waren. Erst jetzt merkt sie, wie leer es überall ist. Nur noch ein wenig Vegetation als letzter Vorposten gegen das Wasser. Als sie näherkommt, sieht sie, dass etwas hinter den hohen Schilfrohren schwappt. Es ist der Engel! Ihr Engel. Er ist hierher gespült worden. Er ist zu ihr gekommen. Er ist wieder da. Sie ist also nicht allein.
Sie schiebt sich durch das kleine Schilfdickicht. Die hohen Halme schneiden in die Wangen. Sie zieht den Engel auf den Sand.
»Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich werde dich nie mehr verlassen.«
Sie dreht den Engel auf die Seite, damit der Flügel nicht am Boden zerbrochen wird. Das zarte Wesen ist mit Seegras gesalbt, und auf dem Rücken sind Spuren dicken, schwarzen Öls.
»Wie du aussiehst! Ich muss das Ärgste abwaschen.«
Sie wühlt im Treibgut und findet ein Stück Schwamm. Dann beginnt sie vorsichtig, damit zu tupfen und zu reiben. Als sie das Seegras aus dem Gesicht des Engels nimmt, ist ihr, als würden die freigelegten Augen zu schimmern beginnen.
»Ich weiss wohl, dass du lebst. Du kannst dich nur nicht bewegen wie wir anderen. Du bist ja hier nicht zu Haus. Es ist bestimmt zu kalt und nass für dich.«
Das Mädchen spült ihre Hände am Rand des Wassers, wringt den Schwamm aus und steckt ihn in die eine Jackentasche. In der anderen hat sie das Brot. Sie kniet vor dem Engel, ganz nah.
»Lieber Engel, es gibt einen Berg dort an Land auf der anderen Seite des Wassers. Der ist nicht so hoch, aber … aber ich kann dich hinbringen. Ich kann dich in meinem Boot rudern. Ich kann dich nach oben tragen und dich vom Gipfel loslassen. Dann kannst du fliegen und nach Haus zurückkehren. Und im Boot habe ich deinen anderen Flügel. Ich glaube schon, dass ich ihn dir irgendwie anbringen kann. Unter der Ruderbank am Heck habe ich ein paar Tampen und alles Mögliche.«
Sie geht los und schleppt den Engel den Hügel hinauf zum Kahn. Und sie ist erstaunt darüber, dass das Wesen so klein ist. Aber sie hätte ihn wohl dennoch nicht auf dem Rücken tragen können. Als sie über das Meer schaut, sieht sie, wie die Dünung sich schwer auf und nieder wölbt. Heute kann sie nicht hinausrudern. Sie muss warten. Sie braucht mehr Brot und kann vielleicht die Nacht in einem dieser Häuser dort verbringen.
Vorsichtig hebt sie den Engel über die Reling, zieht ihre Jacke aus und breitet sie über ihn. Dann begibt sie sich zu dem
Haus, in dem sie das Brot gefunden hatte.
Im warm brennenden Morgenlicht zieht sie den Kahn den kleinen Hügel hinab. Die Räder der Karre unter dem Kahn graben sich in den Sand, aber bald schiebt sie ihr Boot ins Wasser. Sie setzt sich auf die Ruderbank und legt die Riemen in die Dollen. Im selben Augenblick, da sie den ersten Ruderschlag macht, hört sie die Kirchenglocken läuten. Der dumpfe Klang rollt wie mächtige Ringe über das Wasser. Als sie sich nach dem einen Ruder streckt, das ihr aus der Hand geglitten ist, sieht sie, dass sich der Kirchturm noch mehr neigt. Der Boden unter ihm gibt nach, und der hohe Turm stürzt in den Abgrund. Als es nach den absterbenden Glocken still wird, sind ihre Hände weiss und wie festgefroren durch ihren kräftigen Griff um die Riemen. Erst als die wuchtige Sturzwelle den Kahn ergreift und hinausschiebt, beginnt sie, langsam in Richtung Festland zu rudern.
Bald ist sie wie eine durchsichtige Silhouette im leichten, zunehmenden Sonnendunst. Am Heck des Kahns ragt der Flügel des Engels empor und schaukelt sachte wie ein kleines Segel in der nachlassenden Dünung.
»Unser Präsident hat gesagt, dass unsere Insel wiederkommen wird. Ich weiss nicht, ob man das so sagen kann, aber … aber bei euch ist doch Gott der Präsident, oder? Jedenfalls eine Art Präsident. Rettet er auch bei euch Inseln? Wenn ich dich rette – kannst du dann vielleicht unsere Insel retten? Nein, wie dumm von mir. Im Himmel gibt's ja kein Meer. Ich sehe schon, dass du mich blöd findest. Sieh mich nicht so an! Ruh dich lieber aus. Übrigens – ich habe etwas Brot dabei. Vielleicht magst du kein feuchtes Brot. Mag ich eigentlich auch nicht. Würde dir aber trotzdem guttun. Es gibt doch wohl Brot dort, wo du herkommst? Oder?«
Sie nimmt einige Bissen von dem feuchten Brot, reisst ein kleines Stück ab und legt es auf die Ruderbank neben dem Engel. Als sie ins Wasser hinabschaut, sieht sie etwas schimmern: ein Gewimmel von funkelnden kleinen Fischen. Sie tragen den Kahn wie auf einer glänzenden Silberschale voran.
»Ich werde dich zur anderen Seite hinüberrudern. Ich rudere dich nach Haus. Aber weisst du, wenn dein Himmel uns bestraft … Ja, ich weiss ja nicht, ob dein Himmel uns bestraft. Aber ich weiss, dass alles Wasser gekommen ist. Die Alten haben erzählt, dass die Insel früher tausend Häuser hatte. Und ich habe gehört, wie der Bürgermeister davon gesprochen hat, dass das Wasser immer mehr gestiegen ist. Aber du bist gekommen. Ist es dein Präsident, der uns bestraft? Vielleicht. Unsere Fischerboote haben so fürchterlichen, dicken Qualm zu deinem Himmel hochgeschickt. Das habe ich selbst gesehen. Jeden Morgen. Ja, vor den Krabben. Bist du deshalb so wütend? Weil dein Himmel so dreckig wurde? Und so …?«
Sie schaut auf die Bank vor sich. Einige Möwen flattern aufdringlich. Rasch steckt sie das Brot zurück in die Tasche. Ein paar weisse Flecken leuchten auf dem Rücken des Engels. Das Mädchen steht auf, fuchtelt mit den Armen und schreit die Möwen an, die sich davonmachen.
»Ich habe es noch nie jemanden erzählt … aber als ich ganz klein war, war ich dumm. Ich habe einen dicken Stock genommen und Krabben in einem Eimer zerquetscht. Ich weiss, dass das ganz blöd war. Ich habe auch einmal einem Fisch ein Auge ausgestochen. Der hat gezappelt, und das war vielleicht das Schlimmste. Alle die ich kenne, haben Dummheiten gemacht. Bist du deshalb so wütend? Auch deshalb?«
Langsam gleitet sie in die Bucht. Die Stille erstickt das leise Tropfen von den hochgehobenen Ruderblättern. Kleine Ringe werden grösser, umgeben den Kahn und schieben ihn vorwärts. Das Gesicht des Engels schimmert flüchtig auf und zittert in den Strömungswirbeln am Heck.
»Kannst du deinen Präsidenten bitten … vielleicht kannst du das … vielleicht kannst du ihn bitten, dass ich nicht in diese unheimliche Hölle komme, von der Papa gesprochen hat. Aber er war wohl nur fürchterlich wütend. Vielleicht kannst du mir trotzdem helfen. Schliesslich rudere ich dich ja nach Haus. Und dann musst du zurückkommen und mir alles erzählen. Versprich es!«
Das Meer liegt so still, dass die Ringe nach den letzten Ruderschlägen kaum abnehmen wollen. Sie trüben sich nur ein wenig durch die dünnen Wolken, die langsam über den Himmel gleiten. Der Kahn schrapt den Boden. Sie ist angekommen.
Vorsichtig legt sie ein Seil um den Engel und seinen einsamen Flügel. Dann nimmt sie das Seil über ihre Schulter und ergreift es fest mit beiden Händen.
»Jetzt zieh ich dich bis auf den Gipfel.«
Sie beginnt die mühevolle Wanderung. Ein schmaler Pfad führt einen mit Gras bewachsenen Hang hinauf. Hin und wieder bleibt sie stehen und trocknet sich Schweisstropfen von der Stirn.
Dann ist sie oben. Sie setzt sich neben den Engel, um auszuruhen, ehe sie sich nach einer Weile wieder erhebt.
»Bleib einen Augenblick hier und warte. Inzwischen hole ich deinen anderen Flügel. Ich bin sicher, dass du ihn festmachen kannst. Du kannst ja, was wir anderen nicht können. Und ich helfe dir.«
Dann geht sie zum Strand und zum Kahn hinunter.
Als sie mit dem abgebrochenen Flügel und ein paar Stücken unterschiedlich dicker Tampen zurückkommt, ist der Engel fort.
Sie lugt in den Himmel, dreht den Kopf in alle Richtungen. Sie schaut ins Wasser hinunter und über den Sund hinaus. Überall leer. Dann richtet sie den Blick auf die Insel in der Ferne, aber auch dort ist es nur leer. Ein Schwarm kleinerer und grösserer Möwen dreht seine Kreise dort drüben über dem Wasser. Die Vögel scheinen unruhig und verängstigt zu sein. Aber sie sind so weit entfernt, dass sie deren Schreien nicht hören kann.
Wieder schaut sie nach oben.
Nach einer ganzen Weile, als sie schon recht steif im Nacken geworden ist und sich zwischen den Wolken verirrt hat, die begonnen haben, den Himmel zu schliessen, setzt sie sich ins Gras.
Übersetzung aus dem Schwedischen von Jürgen Vater
Artikel-URL:
https://www.untergrund-blättle.ch/prosa/ingvar-hellsing-lundqvist-gezeiten-5992.html
Verwandte Artikel:
Das schwedische Monster (17.07.2020)https://www.xn--untergrund-blttle-2qb.ch/prosa/eckhard-mieder-das-schwedische-monster-sommergeschichte-i-5907.htmlHi !! (08.06.2020)https://www.xn--untergrund-blttle-2qb.ch/kultur/film/der-weisse-hai-1774.htmlUntergrund-Blättle 2024