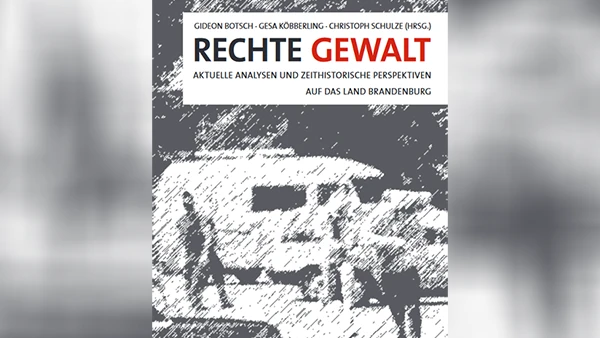Baltimore ist die nächste Station des Aufstands gegen rassistische Polizeigewalt in den USA. Die oberklugen Apologeten der „Gewaltlosigkeit“ sollten endlich schweigen, wenn sie sich schon nicht zur Unterstützung der Riots durchringen können.

Mehr Artikel
Riot-Police in Baltimore während den Unruhen am 25. April 2015. Foto: Vladimir Badikov (CC BY-NC-SA 2.0 cropped)
30. April 2015
0
1
5 min.
Drucken
Korrektur
Bei jedem Riot treffen wir sie an. Diejenigen, die meinen, auf der Seite des „Protests“ zu stehen und das besonders konsequent, weil sie jeden „Gewaltausbruch“ der Demonstranten noch schärfer verurteilen als die ursprüngliche Gewalt, die zu ihm geführt hat. „Klar, total Intelligent die Nachbarschaft zu plündern und dann niederzubrennen. Nicht“, schreibt ein Deutscher aus seiner warmen Stube. „Mein Gott. Was für Chaoten und vor allem Idioten waren dort denn unterwegs? Denken sie wirklich so kann man Polizeigewalt ausgleichen? Rechtfertigt Gewalt Gegengewalt? Und wozu die Ladenplünderungen? Völlig absurd den Tod Grays auf so dumme weise zu entwürdigen. Schämt euch“, mahnt ein Mario B.
Letzterer ist ein gutes Beispiel für die „Gewaltlosigkeit“, die diese Art von Leuten meinen. Während er unter dem Artikel zu Baltimore in zahllosen Postings doziert, dass Gewalt nie und nimmer eine „Lösung“ sein könne, ventiliert er auf seiner privaten Seite Gewaltphantasien gegen die Gewerkschaft der Lokführer (GDL). Die haben nämlich gestreikt, und deshalb kam sein Zug zu spät, er stellt sich also vor, wie schön es wäre, die GDL-Lokführer „zu verprügeln“. Ausserdem hat ein Postbote zu spät geliefert, er fände es also gut, wenn „die Firmengebäude der DHL in die Luft gesprengt“ würden.
Dieser Idiot kann als paradigmatischer Stellvertreter für die meisten der Deppen stehen, die ihren Faible für „Gewaltlosigkeit“ immer dann entdecken, wenn es die Unterschicht ist, die Gewalt ausübt. “If you're not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, and loving the people who are doing the oppressing”, hat Malcom X einmal gesagt. Wenn ihr nicht aufpasst, werden die Medien dafür sorgen, dass ihr die Unterdrückten hasst und die liebt, die für die Unterdrückung verantwortlich sind. Offenbar passen viel zu viele nicht auf.
Schauen wir uns an, was in Baltimore passiert ist. Ein junger schwarzer Mann wurde festgenommen. Schon das Augenzeugenvideo der Festnahme zeigt ihn offenkundig verletzt, er kann kaum noch laufen und wird in den Streifenwagen geschleift. Er schreit vor Schmerzen. Wenig später ist er tot. Sein Genick und seine Wirbelsäule wurden im Polizeigewahrsam gebrochen, woran er verstarb. Er ist nicht der einzige Fall tödlicher Polizeigewalt, nicht der erste und sicher auch nicht der letzte. Sie hat System und sie hat Gründe, die in der Militarisierung der US-Polizei, im institutionalisierten Rassismus und in Klassenunterschieden zu suchen sind.
Die Gewalt, die in Reaktion auf diesen Fall ausgeübt wurde, das Steinewerfen der Jugendlichen in den Strassen von Baltimore, die demolierten Polizeiautos und brennenden Gebäude, sind offenkundig nicht die „erste“ Gewalt hier, sondern eine Reaktion. Wer das nicht versteht, der ist mit Sicherheit Teil des Problems.
Darüber hinaus reagiert nun der Staat erneut mit „Gewalt“ – und zwar mit einer ungleich wirkungsvolleren – gegen die Demonstranten. Er verhängt Ausgangssperren, besetzt die Stadt militärisch mit der Nationalgarde, greift Protestierende an (und zwar friedliche genauso wie „gewalttätige“). Wer in dieser Situation, wie ein nicht unbedeutender Teil der Leitmedien, die ganze Zeit über das „Chaos“, die „Gangs“, die „Plünderungen“ schreibt, lügt. Er lügt, weil er das Gesamtbild bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und den Schwerpunkt auf die Ablehnung der „Gewalt“ der DemonstrantInnen legt. Es wird den Unterdrückten einmal mehr der Mund verboten. Ihr Aufschrei gegen die Gewalt, die ihnen angetan wird, nimmt bisweilen eben selbst gewaltsame Formen an. Doch diejenigen, die zu der tagtäglichen Gewalt schweigen, sprechen nun denen, die sich gewaltsam wehren, die Legitimität ab.
Eine revolutionäre Linke muss anders reagieren. Sie muss den gewaltsamen Aufstand, der spontan entsteht, in organisierte Formen überführen, weil letztere effektiver sind. Lenin hat an Marx anknüpfend 1906 in seiner kleinen Schrift „Der Partisanenkrieg“ über die Frage, welche Aktionsformen denn eigentlich zulässig seien, nachgedacht. Anlass seiner Überlegungen waren – teils organisierte, teils von unorganisierten Grüppchen kommende – bewaffnete Anschläge auf Personen aus dem zaristischen Polizei- und Militärapparat, die einige seiner Parteifreunde ablehnten. Er wies einige Einwände gegen diese Attacken zurück und vertrat einen Kurs der Organisierung des militanten Kampfes. Diejenigen, die pauschal jede Aktion mit der Knarre als „Anarchismus, Blanquismus oder Terrorismus“ bezeichneten, kanzelte er scharf ab. Ihre „schablonenhaften Phrasen“ seien unmarxistisch.
Der Marxismus unterscheide sich „von allen primitiven Formen des Sozialismus dadurch, dass er die Bewegung nicht an irgendeine bestimmte Kampfform bindet.“ Er „erkennt die verschiedensten Kampfformen an“. Zudem müsse der Partisanenkampf mit den „wichtigsten Kampfmitteln (Streik, Massenaufstand – P. S.) in Einklang gebracht werden“, das heisst, er darf nicht kontraproduktiv für diese sein. Er bringe auch „üble Formen“ hervor, weil hier die unorganisierten, wütenden Teile der Bevölkerung „spontan“ handeln. Die Konsequenz sei aber nicht, sich zu distanzieren, sondern diesem Kampf eine organisierte Form zu geben.
Artikel-URL:
Verwandte Artikel:
Black Lives Matter-Demo in Zürich (14.06.2020)https://www.xn--untergrund-blttle-2qb.ch/politik/schweiz/black-lives-matter-demo-zuerich-1683.htmlPolizei und Drogenhandel in São Paulo (26.10.2015)https://www.xn--untergrund-blttle-2qb.ch/politik/ausland/brasilien_spirale_der_gewalt_polizei_und_drogenhandel_in_sao_paulo_2646.html
Untergrund-Blättle 2024