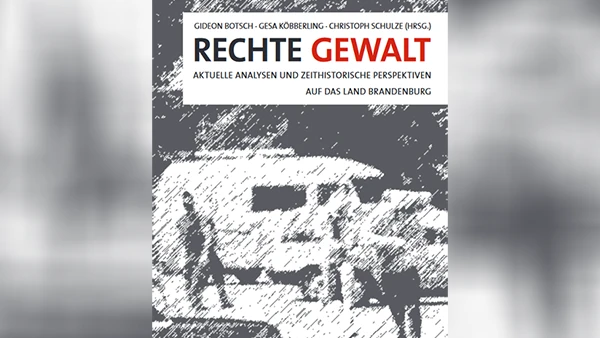Hanf (Cannabis) stammt aus Zentralasien und wurde in China vor 6.000 Jahren bereits zur Herstellung von Kleidung verwendet. Seine psychoaktive Verwendung ist seit ca. 2.500 v.u.Z. dokumentiert.

Indoor Pflanzen in England. Foto: Plantlady223 (CC BY-SA 4.0 cropped)
In der Medizin der europäischen Antike fand das Cannabis z.B. durch Galen Verwendung, und auch für genussorientierte Verwendung zu dieser Zeit und an diesem Ort finden sich vereinzelte Hinweise. Doch gilt Marco Polo (13. Jhd. n.u.Z.) als Mittler dieses Brauches aus der arabischen Welt in europäische Kreise hinein. Hier entwickelte sich wie in Afrika und später vermittels afrikanischer Sklaven auch in (zuerst Süd-, dann Nord-) Amerika eine Gebrauchskultur, die jedoch nie das Ausmass der Verbreitung im Orient erreichte.
Im 19. Jhd. experimentierten vornehmlich Dichter und Intellektuelle mit dieser Droge. Baudelaire und der zugehörige Zirkel "Club des Hachichins" seien stellvertretend genannt. Derart beworben, verbreitete sich der Konsum in esoterischen Runden, doch auch mancher Bauer gewann den heimischen "Knaster" als Rauschmittel lieb. Auf die Idee, dass der Konsum von Cannabisprodukten schuldhaft und unrein sein könnte, kamen dann interessierte Moralunternehmer in den USA. In erster Reihe Harry Anslinger und der Medienzar Hearst sahen die Ursache von vorgeblich grassierenden Vergewaltigungen weisser Frauen und Gewalttaten gegen Weisse in der Gepflogenheit, Marijuana zu rauchen, begründet.
Diese nun war zu der Zeit vor allem unter schwarzen Musikern und mexikanischen ArbeitsmigrantInnen üblich, und der Deckel Drogenphobie stellte sich auf dem Topf Rassismus mal wieder als besonders passend, i.e. massenbegeisternd heraus. Über die Zwischenstufe der Besteuerung wurde die Cannabisprohibition durchgezockt, eben weil die Ideologie des Bösen, das in der pharmakologischen Substanz und den "niederen Rassen", doch nicht in der Organisierung der Gesellschaft liege, dem braven Metropolenbürger seit eh' und je schlüssiger erscheint. Dem die Alkoholprohibition verfechtenden Apparat wurde so ebenfalls ein neues, rettendes Ufer gegründet.
Mit den Genfer Abkommen von 1925 wurde Cannabis dann den Opiaten und dem Kokain auf internationaler Ebene gleichgestellt. Grössere Verbreitung und Gegnerschaft wurde den Cannabisprodukten in Europa erst dank der Protestbewegung der 60er Jahre zuteil. So wie man italienisch essen ging und damit seinem Protest praktisch Ausdruck verlieh, so rauchten viele das "kulturfremde" Haschisch oder Gras. Es wurde, protestgemäss kodifiziert ("Haschisch, Opium, Heroin - für ein freies Westberlin"), Bewusstseinserweiterung zuwider der angestammten Rauschmittelnorm.
Im Gegenzug wurde die Cannabisleidenschaft von den "pigs" (Charles Manson, Lennon/McCartney) mit rigideren Strafen (nun bis zu 10 Jahren Knast) und intensiverer Verfolgung versehen. Nicht ohne diese Massnahme ebenfalls hochtrabend zu begründen, so dass es mal hiess, Cannabis stachele die jungen Leute erst gegen die Gesellschaft auf und mal, Cannabis mache "unsere Jugend" zu "trägen Orientalen". Chromosomenschäden und Degeneration des Sexualtriebes wurden der Begründung angehängt; die Volksgesundheit will gegen ihre imaginären Feinde nach den Massgaben des autoritären Staates verteidigt werden. Diese wilden Thesen der Zahmen jener Zeit widersprachen zunächst den Erfahrungen und Beobachtungen bezüglich eines guten Teils der nun langsam arrivierenden Protestler und in der Folge auch umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchungen.
Auf ihre Devianz und Opposition zu Staat und Gesellschaft legten die Kiffer (1) jedoch in der Mehrheit nur kurze Zeit wert. Als man zu Beginn der 70er Jahre seine eigene Wiese von der der "kaputten Junkies" trennte, setzten die Kiffer zur Untermauerung ihres Leistungswillens in dieser Gesellschaft die Mär der "weichen Droge" (2) in die Welt - und somit die der bösen anderen Drogen gleich mit. Andere gründeten an abgelegenen Orten der Welt esoterische und subsistente Kiffer-Communities. Nachvollzogen und belohnt wurde dieser Anstand im "Cannabisbeschluss" des Bundesverfassungsgerichtes von 1994, demzufolge bei der Sicherstellung von "geringen Mengen zum Eigenkonsum" von einer Strafverfolgung nicht nur abgesehen werden kann, sondern auch soll.
Hauptsächlich aber durch die niederländische Politik der "Trennung der Märkte", die nach Vertreibung der User illegaler Drogen aus dem öffentlichen Raum den Kiffern in Form von Coffeeshops Asyl in guter Stube gewährte. Heute ist es in der zu neuem Selbstbewusstein erwachten Kifferkultur gar integral, dem Willen Ausdruck zu verleihen, zur Mitwirkung an dem Verbrechen des Fortbestands von Herrschaft als Selbstzweck hinkünftig Steuern auf legalisierte Cannabisprodukte gerne zahlen zu wollen. Gebrauch Der Hanfstrauch wird nicht en tout gegessen. Von besonderem Interesse für die/den HaschischkonsumentIn, sei er/sie medizinisch, sei er/sie genussorientiert, sind die weiblichen Pflanzen. Diese tragen Blüten, die das interessante Harz im Laufe einiger Wochen in grossen Mengen produzieren. Diese weiblichen Pflanzen, lediglich von den grossen Blättern befreit, werden nun einmal als Gras (auch weed oder marijuana genannt) dargereicht. Oder sie werden durch Sieben oder - von Stengeln befreit - Pressen zu Haschisch geformt. Bei heute handelsüblichem Haschisch (die grüne "Europlatte") werden jedoch auch weniger potente Pflanzenteile gemahlen und mitgepresst. Unterschiede in der Wirkung von Gras und Haschisch sind nicht verallgemeinerbar. Neben diesen Hauptprodukten kursiert gelegentlich auch reiner, ungepresster Pollen (3) und auch sog.
"Haschöl", das aus der extrahierten Harzdrüsenflüssigkeit besteht. Alle Produkte haben gemein, dass sie im Wirkstoffgehalt, der sich in erster Linie an der Menge der enthaltenen Tetrahydrocannabinole (THC) bemisst, stark schwanken. Synthetisiertes THC hat sich im Gegenteil zu sog. "Grow-Shops", die es in Berlin momentan an jeder Ecke gibt, nicht durchgesetzt. Eine Schwierigkeit ist hier sicher, dass das Zusammenspiel der in der Hanfpflanze vorkommenden Cannabinoide den Reiz des Hanfrauchens ausmacht und - wie oben angeklungen - dem Standardkiffer seine Pflanze heilig ist.
Es gibt für Cannabis keine konsumierbare letale Dosis. Cannabisprodukte werden traditionell gegessen oder geraucht, wobei das Rauchen heute die gängige Variante darstellt. Der Rausch tritt auf diese Weise binnen weniger Minuten ein und klingt gewöhnlich nach einer bis zwei Stunden wieder ab. Das klassische Rauchgerät ist das Chillum, ein konisch geformtes Rohr, das oben zylindrisch ausgehöhlt ist. Von unten wird durch einen schmalen Kanal der Rauch inhaliert.
Furore machte der Joint, eine konisch geformte, grosse Zigarette, die auch durch die Faust geraucht werden kann. Auch Wasserpfeifen haben eine recht lange Tradition und filtern einen gewissen Teil der unerwünschten wie erwünschten Stoffe aus dem Rauch heraus. Hauptsächlicher Vorteil ist auch hier der kühlere, somit besser zu inhalierende Rauch. Als Kaputtnicks gelten unter den Kiffern die Eimerraucher. Sie füllen gewöhnlich einen 10 l Eimer mit Wasser, schneiden den Boden einer (Kunststoff-)PET-Flasche ab, stecken diese Flasche mit dem offenen Boden nach unten ins Wasser, verschliessen dann die obere Öffnung mit einer im Flascheninnern abgesenkten und gelöcherten Aluminiumfolie, auf die das Rauchmaterial gelegt wird.
Die Flasche wird angehoben, Luft durchströmt das entflammte Material, und mit dem Mund wird beim Absenken der Flasche der zunehmend unter Druck stehende Rauch gehalten, bis man ihn - kawumm - in die Lungenflügel ungereinigt einströmen lässt. Die wahrscheinlich ungesündeste Rauchmethode. Gegessen setzt die Wirkung von Cannabis - je nach Mageninhalt und Situation - nach einer halben bis zu zwei Stunden ein. Die Dosierung ist hier schwieriger, hohe Dosierungen mit überraschend intensiven Rauscherfahrungen sind in ungeduldigen ErstkonsumentInnen-Runden häufig.
Ein Gramm Strassenhaschisch/Gras pro Person, in einem lipophilen oder emulgierten Medium (Butter beispielsweise, bei niederer Temperatur zu Keksen verbacken) verarbeitet, ist die Faustregel. Die Wirkung dauert auf diesem Wege wesentlich länger. Fälle von zwanzigstündigem Dauerschlaf oder eintägigen tripähnlichen Erfahrungen sind berichtet, aber nicht die Regel. Im Wechselspiel mit anderen psychoaktiven Substanzen werden Hanfprodukte gelegentlich verwandt, so z.B. zum Abstarten von und glatteren Herausgleiten aus Reisen mit Halluzinogenen wie z.B. LSD.
Auf kombinierten Alkohol- und Cannabiskonsum reagieren einige Menschen mit Übelkeit. Im Orient ist die Cannabisextraktion mit starken Alkoholika nicht unübliches Mittel zur Herstellung eines potenten Rauschgetränkes. Mit Opium versetztes Haschisch, von dem hierzulande immer mal wieder berichtet wird, gehört jedoch mit aller Wahrscheinlichkeit ins Reich der Legenden. Eventuell verleiten überraschend intensive Erfahrungen mit ungewöhnlich THC-reichem Material zu solchen Annahmen. Eine subjektive relative Unempfindlichkeit gegenüber Cannabiseinflüssen stellt sich bei unablässigem Gebrauch ein. Man richtet sich in diesem Fall in der "Rauschumgebung" ein, was einen nicht, selbst wenn man Trucker, Schüler o.ä. ist, in Konflikt mit äusseren Ansprüchen bringen muss. Doch der Rausch verliert den Reiz des Besonderen.
Bemerkenswert am Cannabisgenuss ist, dass der/die ErstkonsumentIn gewöhnlich auch bei hoher Dosierung keinen Rausch erlebt. Dies verleitete einige Wissenschafter zu der Klassifizierung von Cannabis als Placebodroge. In der Tat scheint also ein Erlernen des Cannabisrausches nötig, doch sprechen Berichte von Menschen, die versehentlich/unwissentlich Cannabisgebäck konsumieren und sich einige Zeit später auf einem starken Cannabistrip wiederfanden, gegen die völlige Unbedeutsamkeit der Pharmakologie. Es springt jedoch beim Cannabis ins Auge, dass die Beschreibungen der Wirkung unterschiedlicher sind, als wir dies von anderen Substanzen kennen.
Albernheit und eine Verzerrung der subjektiven Zeitwahrnehmung wird häufig als Phänomen beschrieben. Eine sensorische Sensibilisierung tritt bisweilen auf, was auf die eine oder andere Weise lustvoll ausgekostet werden kann - nicht nur in Verbindung mit Sex. Bisweilen lockert sich die Selbstbeherrschung des bürgerlichen Subjektes - was freilich nicht garantiert ist bei der versteinerten Rauscherwartung des Bürgers, der sich per Kif seiner modischen Devianz versichern, um sein konformes Tagwerk mit dem Schein der Autonomie zu garnieren. Auf die Tat, die einem gerade zur Verfolgung eines Zwecks noch eminent wichtig erschien, wird im Rausch mitunter verzichtet.
Binnen problemintensiver Tätigkeiten, die subjektiv eine baldige und strenge Lösung verlangen, ist die Wahrscheinlichkeit eines schlechten Trips möglich. Es entsteht Verunsicherung über die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges, was nicht immer falsch, aber überrumpelnd und anstrengend kommt. Teils beschreiben KonsumentInnen, dass sie neue Kraft für Aktivität schöpfen, teils, dass sie schlapp und müde werden. Kreislaufprobleme können sich bei dazu Anfälligen leicht, vor allem anfangs, einstellen. Oft genügt es hier, die Beine hochzulegen und locker zu bleiben.
Berüchtigt ist zudem das Austrocknen des Mundes (sog. "Pappmaulsyndrom"), das geradezu nach Milchshakeaufnahme oder vergleichbarem schreit. Zum Glück entwickeln die meisten Kiffer eh' Heisshunger ("Fressflash"), und bei appetitlosen Menschen wird Hanf in den USA sogar schon medizinisch indiziert. Veränderungen in der Wahrnehmung des Raumes werden von Cannabiophagen nach Einnahme höherer Dosen beschrieben. Als Wirkung wird von nahezu allen ein leichteres Abschweifen der Gedanken geteilt, das aber gewöhnlich in Situationen, die es erfordern, von geübten UserInnen abgestellt werden kann. Alles in allem eine gewöhnlich gut der Selbstbeherrschung unterwerfbare Droge.
Eine Modifikation der Pupillengrösse tritt - allen elterlichen Unkenrufen zum Trotz - hier nicht auf. Das Hervortreten rötlicher Adern in den Augen wegen der Abnahme der Tränenflüssigkeit ereignet sich bei vielen. Augentropfen, rezeptfrei in der Apotheke zu haben, helfen hier; nur KontaktlinsenträgerInnen haben damit gewöhnlich körperlich - und nicht wegen der äusseren Erscheinung - zu kämpfen. Im medizinischen Betrieb wird Cannabis zum Anheben der Übelkeitsschwelle in einigen Staaten der USA als Begleitung zur Chemotherapie verwendet. Auch bei Regel- und Kopfschmerzen können Hanfprodukte entspannend wirken.
Weitere Indikationen sind bekannt, etwa beim Grünen Star zur Verringerung des AugenInnendrucks etc. Gesundheitliche Probleme verursacht das Rauchen von Cannabisprodukten, wobei umstritten ist, welchen Anteil hierbei das Kondensat des (zumeist wegen des gleichmässigeren Verbrennens beigegebenen) Tabaks und welchen das Cannabisprodukt ausmacht. Problematisch ist hierbei auch die gewöhnlich tiefere Inhalation des Rauches. Lungenpfeifen und -rasseln kommt bei Kiffern vor; das Risiko, an Krebs zu erkranken, wird gesteigert. Literatur ...gibt es über Cannabis in schier unerschöpflichem Ausmass. Die klassischen literarischen Quellen sind Charles Baudelaires "Les Paradis Artificiels" und das überaus lesenswerte Bändchen "Über Haschisch" von Walter Benjamin (Suhrkamp). Unbedingt lesenswert ist auch Peter Brückners Essay "Macht Haschisch dumm?" (dokumentiert im BAK Drogen Reader "Genuss-Drogen-Politik", bei uns zu bestellen), der auch interessante Anregungen betreffs einer allgemeinen Theorie des Rausches liefert. Das "Deutsche Hanf Handbuch" (Werner Piepers MedienXperimente, Löhrbach) ist ein guter Leitfaden, um sich über die Methoden der Cannabiskultivierung einen Überblick zu verschaffen.
Michael Starks "Marijuana Potenz", das es wie das letztgenannte im gutsortierten "Head-Shop" gibt, enthält interessante und umfangreiche Studien über Auswirkungen von Umwelteinflüssen und genetischen Faktoren auf die Hanfpflanze. Ausführliche Studien der qualitativen Sozialforschung betreffs Cannabiskonsummuster und Lebenswandel von LangzeitcannabiskonsumentInnen hat das 'Institut zur Förderung qualitativer Drogenforschung, akzeptierender Drogenarbeit und rationaler Drogenpolitik' (Anschrift: INDRO, Bremer Platz 18-20, 48155 Münster, http://www.indro-online.de/, E-mail: INDROeV@t-online.de), hauptsächlich Wolfgang Schneider, erarbeitet. Zur Ergründung der Geschichte des Hanfes ist H.G. Behrs "Von Hanf ist die Rede" (Reinbek 1985) und Jonathan Otts "Pharmacotheon" (s. LSD) ein idealer Startpunkt, doch soll auch hier "Drogen und Drogenpolitik" von Scheerer/Vogt nicht unter den Tisch fallen. Unangenehm, aber lohnend ist für den/die IdeologiekritikerIn ein Blick in die immer wieder mit nackten Frauen betitelten Hanfjournale "Grow", "Hanf!" und wie sie alle heissen. Mythenprävention Die richtigen Samen in die Erde gesetzt, entwickelt Hanf auch in kühlen Klimaten genügend THC. Über die Wirkung von THC verfestigte sich hierzulande das Schreckbild des "amotivationalen Syndroms", das die Einstiegssituation des Konsumenten, nämlich sich mal ein bisschen Entzug von der deprimierenden Realität, die im Regelfall mit 10 Jahren Schule und 40 Jahren Lohnknechtschaft lockt, via äusserlicher Zuführung einer psychotropen Substanz zu verschaffen, zum Ergebnis eben dieser Leidenschaft verkehrt. Zum anderen existiert das Bild der "Einstiegsdroge Haschisch", deren Konsum die Pflicht des Heroinkonsums mitsetze.
Diese Behauptung verdankt ihre hölzerne Plausibilität nun einem Zahlenspiel: Man frage 100 Junkies, wie viele von Ihnen vor dem Heroingenuss Cannabis rauchten. Ergebnis: fast alle. Doch die notwendig anzustellende Proberechnung, man frage 100 Menschen, die zumindest einmal im Leben Haschisch konsumierten, wie viele von ihnen Heroin konsumierten, konnte nie mit Erfolg erbracht werden (so ca. jeder 20ste). Für die regierungsamtliche These der Einstiegsdroge spricht in der Theorie, wo ja eben die Empirie schon streikt, nur der besondere Aufwand individueller Stärke, die beim erstmaligen Überschreiten der prekären Grenze der Legalität vonnöten ist.
Ebenfalls nicht haltbar, weil die Psychopharmakologie des Cannabis nach der Veränderung durch den Stoffwechsel ausblendend, ist die von einigen Medizinern gestreute These des Depotphänomens, also einer merklichen Einlagerung der Wirksubstanz im Körper. Sie stützt sich auf Ablagerungen von THC-Abbauprodukten im Fettgewebe. Doch man muss in der Realität - des einen Wohl, des anderen Wehe -, wenn man high werden will, auch nach x-tägigem Dauerkonsum nach kurzer Zeit wieder Cannabis konsumieren, um den Flash zu ernten. Besonderes Interesse verdienen hingegen diejenigen CannabiskonsumentInnen, die von sich selbst behaupten, süchtig zu sein.
Sie sagen, dass sie ohne Cannabiskonsum unruhig werden, und wenn sie unerwünscht wegen Knappheit in eine cannabisfreie Situation kommen, kreisen ihre Gedanken unablässig um die Chance auf das nächste Piece. Wenn sie es sagen und sich so verhalten, dann sind sie abhängig. Jedoch gibt es keine körperliche, sprich unwillkürliche Bindung an die Substanz. Allein die durch eingespielte Maximen des eigenen Willens. Ein Mensch, der täglich morgens duscht, um Erfrischung und Fitness zu erlangen, wird sich, so einmal die Bedingungen der Möglichkeit nicht bestehen, unwohl fühlen und schlapp sein.
Ein Mensch, der täglich Sex hat und damit Entspannung vom Stress des Tages verbindet, wird sich vielleicht unwohl und rastlos fühlen, wenn ihm die Gelegenheit dazu eines Tages ohne seinen dezidierten eigenen Willen versperrt ist. So what? Chronischer Cannabisgebrauch selbst zeitigt keine problematischeren Effekte als tägliches Duschen. Die Tat, die nicht aus dem Erlebnis heraus als unerwünscht klassifiziert wird, sondern gesellschaftlich dem Selbst als Missetat vermittelt wird, schafft erst den besonderen Rechtfertigungsdruck des sogenannten Süchtigen.
Nichts begreift dieses Wort selbst, keine signifikante Differenz existiert zwischen dem das äussere Verdikt verinnerlicht habenden Kiffer und dem unter öffentlicher Hetze leidenden Homosexuellen früherer Jahre. Dieses Problem ist mit Investition einer geringen Portion individueller Stärke leicht negierbar. In der Gefolgschaft von Jack Herer und hierzulande Matthias Bröckers predigen neuerdings viele Hänflinge, dass das Hanfverbot Grund des Übels unserer Welt sei. Man verweist auf den vorgeblichen wirtschaftlichen Vorteil, der der Hanffaser anhafte. Stimmt ökonomisch nicht, interessiert uns hier sowieso nicht, da es um Hanf als Genussmittellieferant geht. Die Wertschätzung von Hanfpapier hat mehr Esoterisches als ökonomisch Rationales. Auch der gewünschte Nebeneffekt, damit das Hanfverbot ad absurdum zu führen, erscheint in der vorgebrachten Form als Akt der Religionsstiftung.
Fussnoten:
1 Kif ist die marrokanische Bezeichnung für Haschisch, die schnell adaptiert wurde.
2 "Weich" macht Cannabis im Verhältnis zu Kokain, Opium, LSD u.s.f. erst das Gerede über seine Harmlosigkeit und die Gefährlichkeit dieser. Nicht im Stoff liegt der Grund der Härte des Junkielebens, sondern in der Brutalität der Bestrafung seiner Leidenschaft durch Staat und Gesellschaft.
3 Der keiner ist, sondern aus den weiblichen Harzdrüsen besteht.
Artikel-URL:
https://www.untergrund-blättle.ch/gesellschaft/cannabis_ueber_haschisch_hanf_und_gras_2869.html
Verwandte Artikel:
183 Millionen Kiffer (22.06.2018)https://www.untergrund-blättle.ch/gesellschaft/cannabis_marihuana_legalisierung_4819.htmlDrogen und Drogenhandel (25.04.2004)https://www.untergrund-blättle.ch/gesellschaft/drogen_und_drogenhandel.htmlUntergrund-Blättle 2024



_(53259728010)_c.webp)