Wolfgang Haug / Michael Wilk: Herrschaftsfrei statt populistisch. Aspekte anarchistischer Gesellschaftskritik Recht behalten oder revolutionär mehr werden?
Sachliteratur
7. Januar 2020
Als eine gelungene Neuauflage ihres 1995 erschienenen gemeinsamen Buchs „Der Malstrom“ präsentieren Wolfgang Haug und Michael Wilk nun dasselbe mit dem Cover „Herrschaftsfrei statt populistisch. Aspekte anarchistischer Staatskritik“.
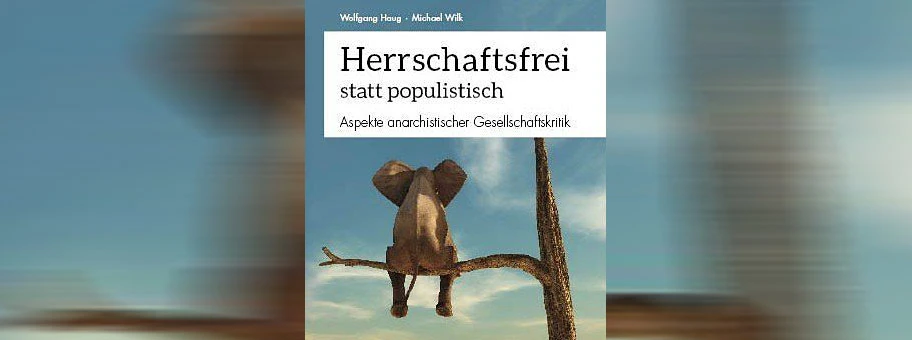
Mehr Artikel
Wolfgang Haug / Michael Wilk: Herrschaftsfrei statt populistisch. Aspekte anarchistischer Gesellschaftskritik Foto: Cover
7. Januar 2020
1
0
11 min.
Drucken
Korrektur
Allerdings handelt es sich genau genommen nicht nur um ein Reprint des alten „Malstroms“, sondern sind diesem noch zwei aktuelle Beiträge vorangestellt mit „Mentaldroge Nationalismus. Völkisches Geschwurbel als politische Strategie“ (Wilk) und „Die Politik der Angst“ (Haug). Hierin, müsste man meinen, sei die Aktualisierung ihrer Gedanken zu finden. Doch schon der Titel macht mich persönlich skeptisch, weswegen ich die beiden Autoren an dieser Stelle einer Infragestellung unterziehen möchte. Diese richte ich an die meisten von uns, mich eingeschlossen. Daher mögen es mir Wolfgang und Michael verzeihen, dass ich meine Infragestellung von ihren Worten ausgehend entfalte. Gern lade sie zu einem guten Essen und einem Vortrag ein. Das ist für mich keine „persönliche“ Angelegenheit und ich fordere sie und euch auch nicht auf, dass ihr „endlich mal mehr machen“ sollt. Ich weiss, ihr sitzt nicht nur im stillen Kämmerlein... Wenn die beiden aber so grosse Worte wie „anarchische Gesellschaftskritik“ zu Papier bringen, erscheint mir deren kritische Betrachtung mehr als gerechtfertigt.
Beide einleitende Texte nehmen den wahrgenommenen sogenannten „Rechtsruck“ zum Anlass, um die Dringlichkeit, aber auch die Möglichkeit von anarchistischer Staats- und Herrschaftskritik zu begründen. Während Wilk sich am stark zugenommenen Nationalismus, der in der AfD seine Manifestierung und Organisierung findet, abarbeitet, bezieht sich Haug vor allem auf die Regierungsform des „Trumpismus“. Es handelt sich um die Bestandsaufnahme zweier zurecht Erschrockener, aus der ich selbst allerdings nichts Neues herauslesen kann.
In diesem Zusammenhang frage ich mich, inwiefern sie damit lediglich dem gängigen Reflex der meisten Linken folgen, die Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse hin zu einem deutlich autoritären Staat und Gesellschaftsarrangement, bloss wahrzunehmen und sich darüber zu empören, anstatt diesem mit einer sozialrevolutionären Herangehensweise etwas entgegenstellen zu wollen. Zugegeben, als Zeitzeugnisse, vielleicht auch als Stellungnahmen, sind solche Dokumente wertvoll. Darüber hinaus finde ich in ihnen jedoch kaum Hinweise, an denen ich meine anarchistische Perspektive weiterentwickeln könnte. Und auch Antwortversuche, die über die Verteidigung des demokratischen Kapitalismus hinausgehen, wagen Wilk und Haug leider nicht.
Grund dafür ist nicht zuletzt eine (meiner Ansicht nach inhaltlich und strategisch) problematische Vorstellung von „Populismus“. So schreibt Wilk beispielsweise: „Der Erfolg populistischer Strategien basiert auf dem Bedürfnis nach Vereinfachung, ja auf der Nachfrage nach einer Form von 'Information', die eben nicht rationales Denken, sondern viel eher Gefühlsebenen wie Wut, Angst und Sicherheit bedient. Ein verlangen nach Aufklärung, nach realen und überprüfbaren Fakten als Denk- und Handlungsgrundlage, gibt es nicht, oder nur in sehr reduzierter Form. Viel stärker zählt die Befriedigung emotionaler Potenziale, seien es Aggressionen oder auch Ängste“ (S. 20).
Anstatt sich aber tiefgehender dem „Denken, Fühlen und Handeln“ zu widmen, an welches sogenannte „PopulistInnen“ anknüpfen könnten, wehrt Wilk Emotionalität im Politischen als irrational und irgendwie tendenziell immer bösartig werdend ab. Genau darauf müsste anarchistische Politik jedoch eingehen.
Selbstverständlich nicht in dem Sinne, mit Rechtsextremen zu reden oder selbst irrational zu argumentieren, sondern, indem Anarchist*innen eigene Gefühle artikulieren und jene anderer anzusprechen versuchen. Sicherlich handelt es sich hier oftmals um Ängste. Diese sind in einer Gesellschaftsform wie wir sie vorfinden, wenn auch schwer zu durchschauen, so doch absolut verständlich und berechtigt. Ein anarchistisches politisches Projekt, welches mit einem pragmatischen sozialrevolutionären Anspruch auftreten würde - sprich, Politik zu machen wagen würde -, müsste gerade hier ansetzen, um populärer werden zu können.
Im Unterschied zum rechten Populismus würde ein sozialrevolutionärer Ansatz Hoffnungen artikulieren, Menschengruppen tatsächlich ermächtigen und die Utopie einer grundlegend anderen Gesellschaft konkret werden lassen. Genau um die „Befriedigung emotionaler Potenziale“ von uns selbst und von anderen, sollte es Anarchist*innen gehen. Dies bedeutet nicht, Leuten falsche Versprechungen zu machen oder dogmatisch irgendwelche Slogans vor sich her zu tragen, von denen viele kaum sagen, geschweige denn glaubhaft vermitteln können, was wir damit eigentlich meinen. Vielmehr können Emotionen im Politischen auch transparent gemacht, thematisiert, zur Diskussion gestellt und somit Reflexionen angestellt werden.
Das Problem, welches Wilk sich mit seinem falschen Verständnis von Populismus einhandelt, ist, dass er diesen nicht ausreichend erfassen und ihm somit auch nicht adäquat entgegentreten kann. Zwar stimmt es, dass Populismus eine Herrschaftsstrategie darstellt, gleichzeitig ist dieser jedoch als Ausdruck eines falschen Bewusstseins zu begreifen. Sein wahrer Kern besteht in der bitteren Erkenntnis, dass sich eine Vielzahl von Menschen unsolidarisch, gewaltsam, ausgrenzend und unreflektiert verhalten, was nicht ausschliesslich daran liegt, dass sie „nicht gelernt haben, sich emanzipativ gegen die eigentlichen Ursachen der Misere zu stellen“ (S. 21).
Es ist richtig, dass echte emanzipatorische Alternativen wenig ausgebaut sind und „in Ermangelung emanzipativer Strategien die es ermöglichen könnten aus einem System des Gegeneinanders auszubrechen, […] Scheinlösungen in Identitäten: als patriotische ordentliche Deutsche oder Verteidiger der abendländischen Kultur“ (S. 22) gesucht werden. Spannend wäre es aber gewesen, Wilk wäre über diese blosse Feststellung hinausgekommen und hätte sich, statt eine Bestandsaufnahme zu machen, genau die Frage gestellt, welche anarchistischen Lösungsansätze für die Misere der Herrschaft denn heute schon bestehen oder entwickelt werden können. Dabei wiederholt er seine Feststellung noch einmal und schreibt, radikale „Ansätze, die in der Lage wären zugrundeliegende Herrschaftsstrukturen nicht nur in Frage zu stellen, sondern lebbare Alternativen zu bieten, sind zu selten existent oder liegen fern der Lebensrealität vieler Betroffener. Genau das gälte es jedoch zu ändern. Eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen“ (S. 31).
Genau hier beisst sich die schwarze Katze jedoch in den Schwanz: Statt Forderungen danach zu stellen, „wir“ müssten uns der besagten Herausforderung stellen, wäre es auch möglich, dies einfach zu tun und zur Abwechselung mal anarchistische Politik zu machen. (Oder zumindest erst einmal eine Perspektive einzunehmen, mit der diese möglich werden könnte, denn ich behaupte und beabsichtige nicht, hier selbst die 'Lösungen' zu präsentieren.) Das hiesse: mehr zu werden, populär zu werden, Emotionen zu artikulieren und anzusprechen, Feinde zu benennen, zu provozieren, zu organisieren, anzugreifen, aufzubauen, gemeinsam mit vielen nach neuen Hoffnungsmomenten zu suchen und eine glaubhafte Grosserzählung für eine egalitäre, freiheitliche und solidarische Gesellschaft zu spinnen. Selbstverständlich muss es in diesem Zusammenhang darum gehen, Dialoge zu ermöglichen, mit die Angst vor der Freiheit abzubauen und mit den Strukturen der Unterdrückung zu brechen, wie Paulo Freire schrieb.
Natürlich kann man all dies als „Populismus“ abtun und verwerfen. Dass bedeutet dann aber schlicht, sich entweder Politik zu verweigern oder bloss demokratisch zu bleiben, also noch nicht einmal einen Lösungsansatz für die Misere zu bieten, der das Label „herrschaftslos“ beanspruchen könnte. Damit möchte ich nicht sagen, dass Kritik „positiv“ oder „konstruktiv“ sein soll. Das muss sie sicherlich nicht. Aber sie bleibt dann eben auch nur Kritik. Wir sollten den Anspruch haben mehr zu tun und konkrete Utopien zu verwirklichen, mit denen sich viele Menschen identifizieren können, weil sie an ihren Lebensrealitäten anknüpfen.
Wenn Leuten Politik Spass macht, sind sie entweder Karrierist*in oder Bürokrat*in. Es gibt viele andere Handlungsmodi, die ebenfalls sinnvoll sind und vor allem weniger entfremden. Und dennoch bleibt Politik zu machen - und sich dazu auch eines ihrer Wesensmerkmale, dem Populismus zu bedienen -, meiner Ansicht nach eine bittere Notwendigkeit. Zumindest wenn die Verwirklichung und Ausbreitung von gelebter und instituierter (= eingerichteter) Anarchie kein schöner Wunschtraum oder exklusives Szene-Projekt bleiben soll. Denn nur wenige können die emanzipierten, selbst-bewussten, autonomen, respektvollen Subjekte sein, die Wilk für nicht-anfällig für „Angstagitation“ hält. Doch auch jenen zahlreichen Menschen, welche nicht die Privilegien und Sicherheiten genossen haben, die für eine solche Persönlichkeitsentwicklung die Voraussetzung ist, bilden die Gesellschaft. Wenn sich etwas grundlegend verändert werden soll, müssen sie mindestens ebenso angesprochen werden. Oder vielleicht sogar gerade sie?
Dies möchte ich auch nach der Lektüre des Textes von Haug fragen, der ja – nachvollziehbar und folgerichtig – eine Kritik an „der“ Politik formuliert, der es darum gehe, „die Ängste zu instrumentalisieren, sie in neue Gesetze und neue Verordnungen zu giessen oder ganz schlicht mehr exekutive Gewalt, mehr Polizei aufzubauen und dadurch die nächste Angst zu kreieren“ (S. 42). Dieser Aussage stimme ich voll zu und lehne die dargestellte „populistische“ Politik Trumps ab. Ich lehne aber auch die populistische Politik Clintons ab oder jene Obamas. Es stimmt, es gibt auch nicht-populistische Politik: Sie wird Technokratie genannt und ist insbesondere mit neoliberalen Kreisen herrschender Gruppierungen verknüpft.
Mario Renzi in Italien, Emmanuel Macron in Frankreich und Angela Merkel in der BRD stehen für technokratische Regierungsstile, die in der Lage sind, die massive Krise des Kapitalismus auf andere abzuwälzen und daraus sogar noch weitere Profite zu schlagen. Das Problem ist nur, dass ihre politischen Strategien nur so lange greifen, wie noch Wirtschaftswachstum generiert werden kann. Bleibt dieses aus, fallen sie alten und neuen Faschist*innen und sonstigen Rechtspopulist*innen zum Opfer und/oder mutieren selbst zu diesen. Der Populismus des rechts-autoritären Hegemonieprojektes funktioniert durch Verkürzungen, Angstmache, Hetze und Ausgrenzung - das stimmt alles und das wissen wir. Aber er wirkt auch deswegen, weil die neoliberalen Technokrat*innen nur Fressen, aber keine Moral und Vision anzubieten haben.
Ich gehe allerdings davon aus, dass viele Menschen tatsächlich eine Politik erleben wollen, in der auch Emotionen eine Rolle spielen, bei der sie den Eindruck haben, dass es dort um grundlegende Fragen, zukünftige Weichenstellungen und irgendwie auch mal um sie geht.
Ich denke nicht, dass es mit Menschen, die ein ganz oder stark geschlossenes und verfestigtes menschenfeindliches und autoritäres Weltbild haben, für emanzipatorisch gesinnte Leute eine gemeinsame Basis geben kann. Aber ich denke, dass wir Emotionen in der Politik ernst nehmen und auch als legitim ansehen sollten. Aus diesem Grund habe ich den Eindruck, Haug verkennt die tatsächlichen umfassenden gesellschaftlichen Veränderungen der letzten zwei Jahrzehnte. Daher sprechen mich seine Schlussfolgerung auch leider kaum an. Mich interessiert es herzlich wenig, „Demonstrationen für die kulturelle Dominanz der Toleranz und Offenheit Europas […], [für] Wertvorstellungen, die sich seit den 70er Jahren in der Bundesrepublik und in ganz Westeuropa ausbreiten konnten“ (S. 44) zu organisieren.
Damit möchte ich die Erfolge, die emanzipatorische Bewegungen erkämpft haben überhaupt nicht abstreiten – sie sind zum Teil das Lebenswerk unglaublich engagierter, leidenschaftlicher Genoss*innen. Ich glaube bloss, dass Haugs bürgerliches Geschwafel von „Toleranz“ Teil des Problems ist, gegen das er sich eigentlich wenden wollte und das seine Überlegungen uns kaum weiterbringen. Wenn er schreibt, eine „neue ausserparlamentarische Opposition wird notwendig, da sich die parlamentarische Plattform zunehmend als Katalysator für den Rechtspopulismus erweist“ (Ebd.), frage ich mich, in welchem Schlaraffenschland Haug denn vorher gelebt hat und in welcher Wohlfühlblase er sich so gemütlich einrichten konnte, dass er sich nun bemüssigt fühlt, sich zum „Verteidiger der Demokratie“ aufzuschwingen. In meiner Lesart ist seine Haltung zutiefst konservativ, die Erkenntnis eingeschlossen, dass die historischen Nazis auf demokratischem Weg die Macht ergriffen und sich staatlich-demokratischer Mechanismen bedient haben. Diesen Gemeinplatz festzustellen ist noch längst keine Staatskritik.
Letztendlich zeigt sich also, dass Michael Wilk und Wolfgang Haug genau der Angst erliegen, gegen welche sie eigentlich anschreiben wollten. Der eigentlichen Herausforderung, nach Antworten zu suchen, stellen sie sich nicht. Dass rechts-autoritäre Hegemonieprojekt ist manifester Ausdruck, organisierter Sumpf und radikalisierender Motor weit tiefer gehender gesellschaftlicher Verschiebungen hin zu einer autoritären Gesellschafts- und Regierungsform, wie sie sich in Russland, der Türkei, in Ungarn, Polen, etwas abgeschwächter in den USA und Brasilien oder anderen Ländern systematisch etablieren konnte (In China, dem Iran, Ägypten, Saudi-Arabien, den Philippinen, etc. gibt es zwar ebenfalls autoritäre Regime, die aber ein anderes Phänomen darstellen).
Wer denkt, dagegen seien die besten Mittel solche, welche neben der blossen Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation, lediglich auf einen Bestandsschutz für vertraute und liebgewonnene Demonstrationen der moralischen und intellektuellen Überlegenheit abzielen, gleicht einem Elefanten, der auf dem Ast sitzenbleibt, auf dem er sitzt. Vielmehr bedarf es der Organisierung einer sozialrevolutionären Bewegung, die populär, egalitär und solidarisch ist, die mit der Vision einer lebenswerten Zukunft erfüllt ist und die Hoffnung verbreitet, das ein libertärer Sozialismus im 21. Jahrhundert weltweit möglich (gemacht) werden kann. Für mich ist dies keine hohle Phrase, sondern die Quintessenz anarchistischer Gesellschaftskritik sowie eine notwendige konkrete Praxis.
Sicherlich kann dies mit einem kleinen Büchlein gar nicht geleistet werden. In begrenztem Rahmen könnte dazu jedoch zumindest beigetragen werden, indem darin eine sozialrevolutionäre Perspektive eingenommen wird. Damit meine ich ausdrücklich nicht, eine Avantgarde zu bilden, sondern Bewusstseinsbildung nicht für, sondern mit Menschen in verschiedenen Unterdrückungspositionen zu betreiben.
Eine Erwiderung zu dieser Rezension findet sich unter: https://fda-ifa.org/gai-dao-no-100-april-2019/
Wolfgang Haug / Michael Wilk: Herrschaftsfrei statt populistisch: Aspekte anarchistischer Gesellschaftskritik. Verlag Edition AV 2018. 130 Seiten. ca. 16.00 SFr. ISBN 978-3868412079
Artikel-URL:
Verwandte Artikel:
Gretchenfrage an das Volk (13.12.2018)https://www.xn--untergrund-blttle-2qb.ch/buchrezensionen/sachliteratur/chantal_mouffe_fuer_einen_linken_populismus_5212.htmlSebastian Kurz: Populistischer Vollholler? (06.07.2017)https://www.xn--untergrund-blttle-2qb.ch/politik/oesterreich/sebastian_kurz_populistischer_vollholler_4214.htmlUntergrund-Blättle 2024





