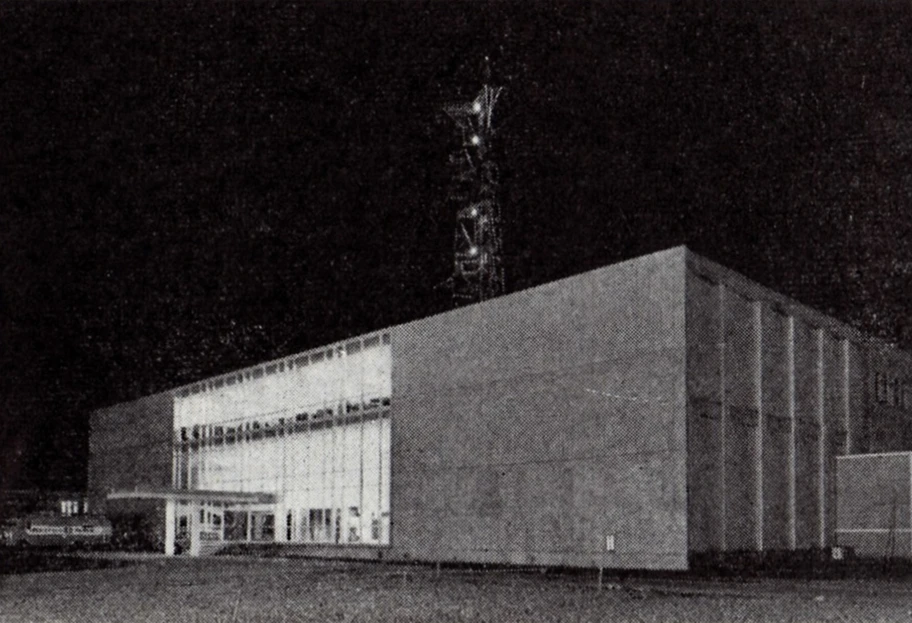Verständlich wird dieses doppelte „für alle“ bereits an den ersten Zeilen: Dort geht es um die Frage, warum man an Eltern den Anspruch stellt, bedingungslose Liebe für ihre Kinder zu haben. Denn was ist, wenn diese Liebe ausbleibt oder Eltern ihrem Kind sogar systematisch Gewalt antun? Darin stellt sich implizit auch schon die Frage nach der Gesellschaft: Wie reproduziert sie sich überhaupt? Was ist an Sorgearbeit dafür notwendig? Rosenblatt verarbeitet diese Nicht-Erfahrung mit „aufgeschrieben“ in einer Art traumaaufarbeitender Inszenierung, in der verschiedene Instanzen ihrer Person (oder Personen) mit ihren fiktiven, abwesenden Eltern sprechen. „Ich lebe ein frei_von_bedingungsloser_Liebe-Leben“ (S. 69), sagt eine dieser Personen. Eine andere Person sagt: „Ihr habt uns eure Verantwortung aufgeladen und für eure Privilegien bezahlen lassen. Das ist aber nicht, wozu Kinder da sind.“ (S. 23)
Die Frage „Was ist passiert?“ steht immer im Raum, wird aber nicht einfach beantwortet. Darum geht es (nicht). Der Schreibprozess ist selbst Teil der Traumaverarbeitung. Überhaupt etwas aufschreiben zu können, ist häufig erst das Produkt langer Trauer- oder Traumaarbeit. Zwang, Gewalt, Ausbeutung, Entfremdung, Schmerzen, Dissoziation, Verzweiflung, Depression, Suizidalität – das Schreiben des zerrissenen Subjekts ist allgemein nicht einfach gegeben, sondern muss immer erst prekär hergestellt werden. Im Nachwort schreibt Rosenblatt:
„Ich kann von mir als Ich schreiben, obwohl ‚Ich' zu Beginn des Schreibprozesses noch viel mehr ein ‚Wir' bedeutet hat. Und glaube heute, dass es ohne das viele Schreiben nie dazu gekommen wäre.“ (S. 93)
Die Vielen blicken auf das Trauma und sprechen mit ihren fiktiven Eltern, Rosenblatt als Erzähler_in protokolliert das heterogene Sprechen und die Stille dazwischen. Traumaaufarbeitung ist keine lineare Abhandlung.
Produktion und Reproduktion – zwei Modi der Gewalt
Die Familie, die das Verhältnis Eltern-Kind konstituiert, ist eines der komplexesten Abhängigkeitsverhältnisse überhaupt. Kaum an einem anderen Ort der Gesellschaft kann die Macht der einen über die anderen so absolut werden. Im Spätkapitalismus ist die heteronormative Kleinfamilie nun nach wie vor ein Ort von systematischer Gewalt. Der Ort, an dem die unbezahlte Reproduktion der Arbeitskraft geschlechterspezifisch arrangiert und durch misogyne Gewalt von Misshandlung bis Femizid unterlegt ist.Die Klasse der Lohnabhängigen ist auch in den kapitalistischen Zentren nicht eine, sondern immer noch entlang verschiedener gesellschaftlicher Macht- und Ausbeutungsverhältnisse gespalten. Der ausgebeutete männliche Arbeiter kann immer noch seine Frau schlagen, die Eltern können immer noch den Kindern Gewalt zufügen. Genau diese Analyse von Macht wird in Rosenblatts Werk implizit immer wieder sichtbar – auch, indem es etwa nicht nur um die ursprünglich erfahrene Gewalt in der Familie geht, sondern um deren kontinuierliche Deckung und Reproduktion. Also um so etwas wie das Versagen von primärer und sekundärer Zeug_innenschaft der Gesellschaft.
„So viele Erwachsene waren daran beteiligt, dass niemand etwas erfährt, selbst wenn jemand etwas erfährt. Das ist das Bitterste an all dem. […] Die Horterzieherinnen, die es gesehen haben. Die es gewusst haben, weil wir Kinder es ihnen gesagt haben. Die Lehrerinnen. Die Psychologinnen, die die Folgen an mir glasklar vor der Nase hatten.“ (S. 61)
Die direktere Gewalt der Reproduktionssphäre, die die abstraktere Ausbeutung der Produktionssphäre in anderer Form spiegelt, soll unsichtbar bleiben. Betroffene werden in ein Leben gedrängt, in dem sich die ursprüngliche Auslieferung gegenüber gesellschaftlichen Institutionen (Pflegefamilie, Psychiatrie und so weiter) wiederholt. Im Spätkapitalismus hat das einen doppelt enthüllenden Charakter, da das Individuum sowohl die versprochene Liebe der zentralen Reproduktionsinstanz Familie nicht erfährt als auch die kompensatorische Reproduktionsarbeit als kapitalistisch verdinglichte erfahren wird: „Schlecht war der Ersatzcharakter. Schlecht war meine Rolle als Kostenfaktor mit Potential, das keinerlei tiefere Verbindung zu den Menschen als Ganzes eingehen durfte. Niemals. Jemals.“ (S. 45)
Eine Schuld, die nicht sühnbar ist
Man sagt, der Charakter einer Gesellschaft zeige sich besonders am Umgang mit ihren machtlosesten Mitgliedern. Die Vielen in „aufgeschrieben“ sind aber nicht mehr machtlos, sie haben Sprache, sie sind nicht blosse Opfer. Sie machen Traumaarbeit sogar für alle sichtbar. Am Ende sagt eine der Personen zu ihren Eltern. „‚Ich hasse euch nicht.' Sie stehen im Rahmen der Küchentür und schauen sie ein letztes Mal an. ‚Nicht einmal das.'“ (S. 81) Das Subjekt hat sich über eine spezifische Trauma- und Trauerarbeit konstituiert, die Personen, die die primäre Gewalt ausgeübt haben, werden nicht mehr gebraucht, noch nicht einmal mehr als Objekt von Hass.Obwohl das Ende dieser Traumaarbeit mit den fiktiven Eltern vielleicht erreicht ist, ist es die allgemein notwendige Trauerarbeit der Gesellschaft bestimmt nicht. Eine andere Person sagt: „Das ist, was ich empfinde, wenn ich erfahre, wie viele andere Menschen nicht überlebt haben. Ich empfinde da kein Mitleid oder denke, dass es hätte verhindert werden können. Das ist einfach nur Schuld, die nicht sühnbar ist. Weder mit einem nachträglichen Sterben noch irgendeiner anderen Geste.“ (S. 64)
Im Nachwort und der „Lesehilfe“ von Mai-Anh Bloger werden die Leser_innen mit einiger Vehemenz daran erinnert, dass Zeug_innenschaft immer prekär ist und Verstehen zwischen Ungleichen entlang gesellschaftlicher Machtverhältnisse scheitert: „Wenn Sie, verehrte Leser_innen, hier angekommen sind, haben Sie sich schuldig gemacht.“ Und: „Jeder Versuch zu verstehen, jede Anmassung, verstanden zu haben zumal, nimmt das allzu freie Subjekt gefangen.“ (S. 85)
Die Schuld der Leser_innen zu fokussieren statt den Zusammenhang zwischen traumatisiertem Individuum und gesellschaftlicher Gewalt allgemein zu beleuchten, wirkt allerdings auch verkürzt. In Zeiten eines neuen Hauptwiderspruchsdenken und permanenter „Kritik“ von sogenannter Identitätspolitik ist es sehr wichtig, das Singuläre gegenüber dem Allgemeinen zu bewahren und einen falschen Universalismus zurückzuweisen. Gesellschaftliche Gewalt trifft je nach Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Positionierungen anders.
Aber man wird dem Besonderen nicht gerecht, wenn man in dieser Weise vom Allgemeinen abstrahiert, ein „allzu freies Subjekt“ postuliert und individuelle Schuldsprüche verteilt. Die spezifische Traumaaufarbeitung bekommt viel eher vor dem gesellschaftlichen Hintergrund ihre volle Bedeutung. Aus einer linken Perspektive gilt es davon ausgehend gewiss Verhältnisse zu schaffen, in denen Produktion und Reproduktion anders und weniger gewaltvoll organisiert werden. In denen ein Individuum auf sichere Care-Strukturen vertrauen kann und nicht permanent einer mehrwertorientierten Ausbeutungs-Logik unterworfen ist.
Im Hier und Jetzt ist es wichtig, die krassesten Härten von Leid durch Zeugen_innenschaft, Zuhören, Solidarität abzumindern. Gerade daran, Marginalisierten zuzuhören, scheitert die Linke gegenwärtig oft. Obwohl dadurch vielleicht so viel über das Singuläre und das Ganze verstanden werden könnte. Das Singuläre gleich zu machen oder ganz anders sind zwei Seiten einer Medaille, die diesem nicht gerecht werden.